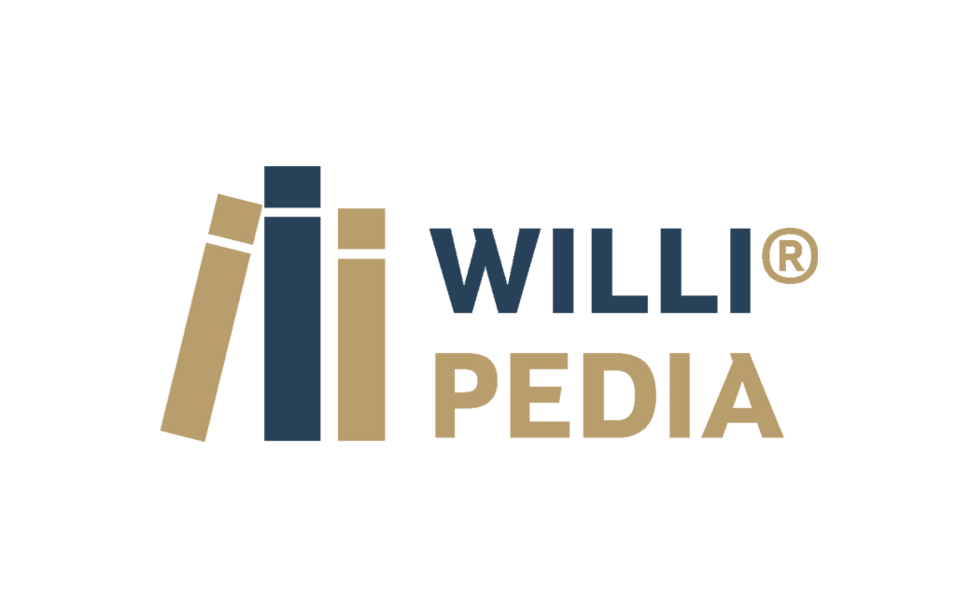Ziehen die Wohlhabenden weiter? Steuerpolitik im Zeitalter der Mobilität
08. September 2025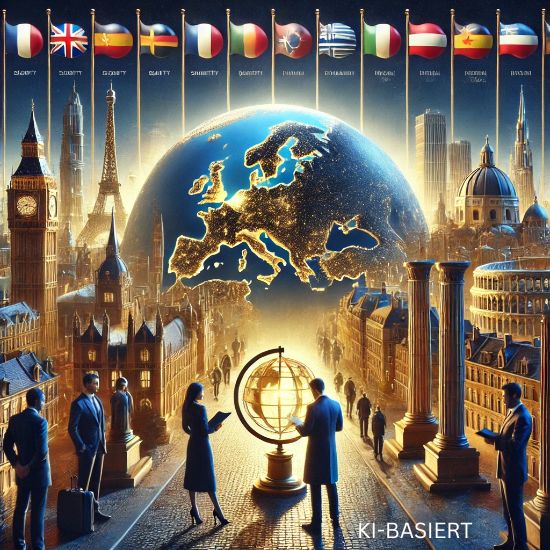
Während viele Länder über Wege nachdenken, wie sie ihr Finanzsystem stabilisieren und soziale Ausgaben absichern können, erleben wir ein Phänomen, das alte politische Rezepte ins Wanken bringt: Die finanzielle Oberschicht entzieht sich zunehmend dem Zugriff nationaler Steuerpolitik – nicht durch Tricks, sondern durch Ortswechsel.
In einem global vernetzten Zeitalter ist Geld nicht mehr an Ort und Nation gebunden – und die, die es besitzen, sind es auch nicht. Menschen mit hohem Einkommen und internationalem Vermögen weichen Steuerbelastungen aus, indem sie ihr Leben neu organisieren – mit Wohnsitzen in steuerfreundlicheren Regionen, international kenntnisreichen Steuerberatern und Anwälten sowie einer Mobilität, die früher nur Staatsoberhäuptern vorbehalten war.
Das Ende eines alten Vorteils
England hat kürzlich ein traditionsreiches Steuermodell abgeschafft, das es vermögenden Zuzüglern bislang erlaubte, große Teile ihres Einkommens außerhalb der nationalen Steuerbehörden zu belassen. Jahrzehntelang galt dieses Modell als Türöffner für internationale Investoren, Unternehmer und reiche Familien, die ihren Wohnsitz dorthin verlagerten – samt Kapital, Familie und Arbeitsplätzen.
Doch nun wurde der Sonderstatus gestrichen – mit dem politischen Kalkül, bis zum Ende des Jahrzehnts Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen zu generieren. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Wohlhabende Zuzügler packen ihre Koffer, verkaufen Immobilien und ziehen in Länder, die ihnen keine finanzielle Extra-Bürde auflegen.
Abwanderung als Antwort
Für viele, die einst mit offenen Armen empfangen wurden, ist das Signal klar: Sie fühlen sich nicht mehr erwünscht. Unternehmer, Investoren und vermögende Familien mit komplexen Einkommensstrukturen reagieren auf politische Veränderungen nicht mit Protest – sondern mit Umzug.
Die neuen Ziele heißen nun: Dubai, Monaco, Schweiz, Griechenland oder Italien. Dort winken pauschale Steuermodelle, minimale bürokratische Hürden und ein Lebensstil, der sich mit internationalem Lebensstil ideal verträgt. In einer Welt, in der ein Steuerberater in Zürich, auf Mallorca oder in Dubai mehr Einfluss auf die Wahl des Wohnortes hat als ein Premierminister in London oder Paris, ist ein Wohnsitzwechsel kein Versteckspiel mehr – sondern schlicht Standortpolitik. Mallorca steht dabei exemplarisch für eine neue Realität: Familie, Vermögen und unternehmerische Tätigkeiten folgen nicht mehr zwingend demselben Ort – sie werden global verteilt und bewusst dort positioniert, wo die Rahmenbedingungen stimmen.
Mobilität als Machtfaktor
Die große Lehre: Reiche sind nicht nur wohlhabend – sie sind auch hochmobil. Sie leben nicht dort, wo sie geboren wurden. Sie arbeiten nicht nur dort, wo sie wohnen. Und sie zahlen nicht zwangsläufig Steuern dort, wo sie wirtschaften.
Mit mehreren Wohnsitzen, digitalen Geschäftsmodellen, steuerlicher und juristischer Expertise und einem Netz an globaler Infrastruktur ist es gangbare Option, sich der nationalen Steuerpflicht durch Ortswechsel zu entziehen. Wer ein Vermögen in Millionenhöhe verwaltet, verlässt ein Land nicht aus Laune, sondern aus Kalkül.
Selbst Regierungen räumen inzwischen ein, dass sie bei der Einführung neuer Steuerregeln mit einer gewissen Abwanderung rechnen müssen. Doch neue Daten deuten darauf hin, dass die internationale Mobilität bereits größer ist als von der Politik erwartet und weiter zunehmen wird – mit erheblichen Folgen für die Staatshaushalte.
Zwischen Reform und Risiko
Ökonomen warnen: Wenn die wohlhabendsten Steuerzahler gehen, nehmen sie nicht nur ihre Abgaben mit. Sie hinterlassen auch langfristig signifikant wirksame Lücken bei Investitionen, Konsum und Arbeitsplatzschaffung. Immobilien verlieren an Wert, private Dienstleister verlieren Kunden.
Der jüngste Bericht eines unabhängigen Wirtschaftsinstituts zeigt: Sollte in England ein Viertel der betroffenen Reichen gehen, könnten die erhofften Zusatzeinnahmen ins Gegenteil kippen – ein Nettoverlust für die Staatskasse.
Gleichzeitig gibt es auch optimistische Stimmen. Eine Untersuchung zur Wirkung früherer Steuerreformen zeigte, dass viele Reiche zwar bleiben – und dann auch deutlich mehr zum Steueraufkommen beitragen. Die Frage ist also nicht nur, wie viele gehen – sondern wer bleibt, und warum.
Emotionale Entscheidungen in einer globalen Realität
Nicht jeder verlässt sein Gastland leichtfertig. Manche haben dort Familien gegründet, Unternehmen aufgebaut, in Kulturprojekte investiert oder historische Gebäude restauriert. Doch sobald der fiskalische Druck steigt und das Gefühl aufkommt, nicht mehr als wertvoller Teil der Gesellschaft gesehen zu werden, wandelt sich der Traum vom Leben im Ausland in einen Koffer auf Rädern.
Einige von ihnen ziehen nun in Staaten, die mit Steuerpauschalen locken – dort zahlen sie eine fixe Summe pro Jahr, unabhängig von ihrem tatsächlichen Vermögen oder Einkommen. Für sie ist das nicht nur eine finanzielle Entscheidung, sondern auch eine Lebensstrategie.
Ein globales Dilemma – und ein politisches Paradox
Der Fall England zeigt: Mobilität ist längst ein geopolitischer Hebel. Steuerpolitik, die früher als rein nationale Angelegenheit galt, steht heute im globalen Wettbewerb. Wer die Reichen halten will, muss mehr bieten als politische Stabilität und gute Schulen – es geht um Wettbewerbsfähigkeit im Steuerrecht, Visafreiheit, Lebensqualität und das Gefühl, willkommen und wertgeschätzt zu sein.
Doch genau hier liegt der Widerspruch: Wie soll ein Staat gleichzeitig solidarisch und wettbewerbsfähig sein? Wie lässt sich Gerechtigkeit schaffen, ohne Kapital zu verlieren? Und wie kann Mobilität gefördert werden – ohne dass sie zum Entkommen genutzt wird?
Fazit: Steuerpolitik im Zeitalter der Mobilität
Das globale Steuerkarussell dreht sich schneller denn je. Während Regierungen versuchen, durch gerechtere Systeme die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, fliehen die Vermögenden in freundlichere Gefilde.
Die Welt wird zur Bühne für ein neues Rennen um die Reichsten. Wer in Zukunft gestalten will, muss nicht nur Gesetze schreiben, sondern auch verstehen, wie sich Kapital bewegt. Nur dann lässt sich ein Steuersystem finden, das internationale Wettbewerbsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit vereinbart – und dennoch Bestand hat im Zeitalter des freien Flugs.
Das Thema steht neben weiteren Schwerpunkten bei unserem Event “Familienvermögen in Krisenzeiten” Ende Januar auf dem Programm. Hier geht's zu Infos, Referenten und Anmeldung.
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
-
Nicht-EU-Bürger im Niemandsland: Regierung kämpft gegen Urteil, das Diskriminierung bei Vermietung beseitigt
Update: Bei der Vermietung spanischer Immobilien können unter anderem Schweizer laut aktueller Gesetzeslage ihre Kosten nicht geltend machen. Der Nationale Gerichtshof hält das für EU-rechtswidrig.
News - 12. Januar 2026
...mehr -
Justiz in Spanien erklärt Diskriminierung von Nicht-EU-Bürgern bei Vermietung für unzulässig
Unter anderem Schweizer können aktuell ihre Kosten nicht in der spanischen Steuererklärung geltend machen. Das sei nicht mit EU-Recht vereinbar, urteilt der Nationale Gerichtshof.
News - 26. August 2025
...mehr