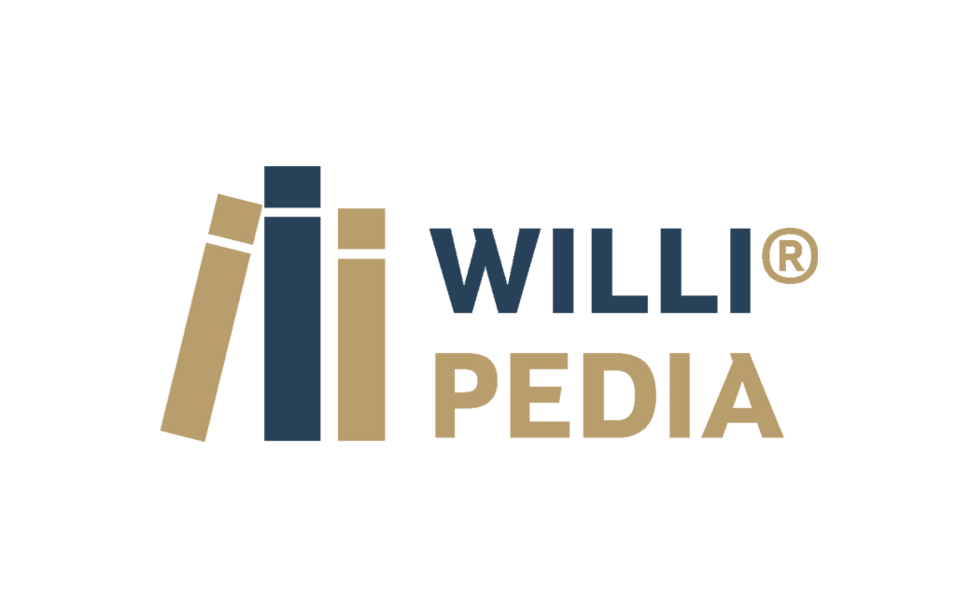Erbschaftsteuer | Fokus Spanien & Balearen
Erstveröffentlichung: 29. Oktober 2021
Im Jahr 2023 hat die balearische Landesregierung die Erbschaftsteuer für direkte Verwandte – Eltern, Kinder, Enkel, Großeltern sowie Ehegatten (Verwandtschaftsgruppen I und II) – nahezu vollständig abgeschafft. Auch Nichtresidenten profitieren von dieser Begünstigung.
Im Juli 2025 folgte eine weitere Reform: Nun gibt es auch deutliche Entlastungen für Angehörige der Verwandtschaftsgruppe III, also Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Stiefkinder sowie Schwiegersöhne und -töchter. Die Reduktion der Steuerlast steigt in dieser Gruppe von 50 auf 60 Prozent, sofern keine direkten Nachkommen vorhanden sind. Für die übrigen Fälle innerhalb der Gruppe III beträgt die Entlastung 35 statt zuvor 25 Prozent.
Damit setzt die Regierung den eingeschlagenen Kurs der Entlastung fort, während zugleich weiterhin über eine langfristige Neuregelung der Erbschaftsteuer diskutiert wird.
Das komplexe Thema Erbschaft- und Schenkungsteuer in Spanien
Besonderheiten in Spanien
Die erwähnten weit reichenden Gesetzgebungskompetenzen der regionalen Regierungen haben nicht nur für deren Bewohner Konsequenzen, sondern seit 2015 auch für Nichtresidenten, die seither unter bestimmten Bedingungen für das regionale Steuerrecht optieren können.
Die wichtigsten gemeinsamen Merkmale der Erbschaft- und Schenkungsteuer aller Regionen betreffen die Besteuerung des Wertzuwachses eines übertragenen Vermögenselements. Bei der Erbschaftsteuer verzichtet der spanische Staat ausdrücklich auf die Besteuerung dieses Wertzuwachses. Das bedeutet: Mit dem impuesto de sucesiones ist der Vorgang erledigt und der Erbe kann den für die Erbschaftsteuer ermittelten Verkehrswert als Anschaffungswert für eine spätere Veräußerung ansetzen. Dies kann etwa bei Immobilien oder Gesellschaftsanteilen erhebliche Auswirkungen haben.
Hingegen löst eine Schenkung beim Schenker Einkommensteuer aus, wenn das geschenkte Gut zwischen Erwerb und unentgeltlicher Weitergabe im Wert gestiegen ist. Das führt trotz fehlendem Liquiditätszufluss zu einer Besteuerung ähnlich einem Verkauf.
Balearen seit Juli 2025: Die Schenkungsteuer wurde an die Erbschaftsteuer angeglichen. Für Angehörige der Verwandtschaftsgruppen I und II (Eltern und Kinder, Großeltern und Enkel, Ehepartner) gilt eine Ermäßigung von 100 Prozent, die Steuer fällt praktisch nicht mehr an. Für Blutsverwandte zweiten und dritten Grades (unter anderem Onkel, Tanten, Nichten, Neffen) beträgt die Reduktion 60 Prozent, für die übrigen Angehörigen der Gruppe III 35 Prozent. Bei Immobilienschenkungen sind die Abzüge nur anwendbar, wenn der vereinbarte Wert den Katasterreferenzwert um höchstens 20 Prozent übersteigt. Unverändert bleibt die Einkommensteuerpflicht des Schenkers auf den Wertzuwachs. Die Erleichterungen gelten ab Veröffentlichung im Gesetzesblatt Ende Juli 2025 und nicht rückwirkend.
Die zuvor typischen sehr geringen oder fehlenden Freibeträge sowie hohe Multiplikationskoeffizienten gelten damit auf den Balearen für enge Verwandte faktisch nicht mehr, bleiben aber als allgemeiner Spanien-Hinweis für andere Regionen relevant. Zusätzlich sind die Erbschaftsteuersätze für die Gruppe III auf den Balearen erhöht begünstigt. Der Pacto Sucesorio (Nachfolgepakt) bleibt als Sonderform in den wenigen dafür vorgesehenen Regionen, darunter die Balearen, weiterhin bedeutsam.
Besonderheiten in Deutschland
Hier sollen nur beispielhaft zwei Besonderheiten erwähnt werden, um zu illustrieren, wie unterschiedlich die Erbschaftsteuer in den beiden Ländern geregelt ist.
Die wohl herausragendste Eigenheit des deutschen Erbschaftsteuerrechts ist die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht, die dazu führen kann, dass ein im Ausland ansässiger Erbe unabhängig von der Belegenheit des Nachlassvermögens und trotz Ansässigkeit im Ausland in beiden Ländern das gesamte Erbe versteuern muss (siehe dazu Punkt 4.1).
Aus spanischer Sicht ist bemerkenswert, dass in Deutschland der Wertzuwachs eines geerbten Gutes von den Erben zu versteuern ist, da sie im Erbfall die ursprünglichen Anschaffungskosten vom Erblasser übernehmen und diese im Fall eines Verkaufs in der Zukunft als Grundlage für die Berechnung ihres steuerlichen Gewinns heranziehen müssen („Fußstapfen-Prinzip“).
Die Verwandtschaftsgruppen auf den Balearen
Für die Ermittlung der Besteuerung ist die Verwandtschaftsgruppe ein maßgeblicher Faktor. Auf den Balearen sind diese Gruppen wie folgt unterteilt:
- Verwandtschaftsgruppe I: Abkömmlinge unter 21 Jahren (Kinder, Enkelkinder, ...)
- Verwandtschaftsgruppe II: Direkte Verwandte der absteigenden Linie (21 Jahre und älter) (Kinder, Enkelkinder, ...) Direkte Verwandte der aufsteigenden Linie (Eltern, Großeltern) Ehepartner sowie Lebensgefährten bei amtlich eingetragener Lebenspartnerschaft
- Verwandtschaftsgruppe III (A)*: Blutsverwandte der Seitenlinie 2. und 3. Grades (Geschwister, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, ...) Eingeheiratete Verwandte der aufsteigenden und absteigenden Linie ohne Blutsverwandtschaft (Stiefsohn/-tochter, Stiefvater/-mutter, Schwiegersohn/-tochter, Schwiegereltern, ...)
- Verwandtschaftsgruppe III (B)*: Eingeheiratete Verwandte der aufsteigenden und absteigenden Linie 2. und 3. Grades (Stiefneffe/-nichte, Stiefonkel/-tante, ...)
- Verwandtschaftsgruppe IV: Verwandte der Seitenlinie 4. Grades oder kein Verwandtschaftsverhältnis (Cousins, Freund/in, Geliebte/r, juristische Person, ...)
*Die Unterteilung der Verwandtschaftsgruppe III in zwei Untergruppen ist eine Besonderheit des balearischen Erbschaftsteuerrechts. Mit der Gruppe III (A) wurde eine etwas begünstigte Kategorie für nähere eingeheiratete Verwandte geschaffen. Ansonsten stimmt die Unterteilung mit der staatlichen überein.
Ermittlung der Bemessungsgrundlage
Die Bemessungsgrundlage bezeichnet den Wert, auf den die Steuer anfällt. Per Januar 2022 gilt in Spanien eine neue Regelung: Als Mindestwert ist ein so genannter Referenzwert (Valor de Referencia) anzusetzen. Dieser Wert wird vom Katasteramt für jede spanische Immobilie alljährlich neu festgelegt, erstmals für 2022. Wesentliche Faktoren für die Wertermittlung sind die für jede Zone eines Siedlungsgebiets erfassten Quadratmeterkosten gemäß der faktisch getätigten Immobilienübertragungen, die von den Notariaten gemeldet werden, sowie die Größe der Immobilie. Bei Redaktionsschluss dieses Wegweisers ist die Regelung noch nicht in Kraft, daher liegen keine Erfahrungswerte vor. In Fachkreisen ist man sich jedoch einig, dass der Steuerwert von Substandard-Immobilien in Hochpreislagen am stärksten betroffen sein wird, mit einer entsprechend erhöhten Steuerbelastung für den Erben. Befindet sich die Immobilie in einer Gesellschaft, so wird die Bilanz zu Zwecken der Erbschaftsteuer um den Verkehrswert der Immobilie korrigiert.
Danach spielen zwei Größen in die Berechnung hinein: Der Freibetrag und der Hausrat. Die Freibeträge sind in Spanien im Vergleich sehr niedrig. Auf den Balearen liegt dieser für die Verwandtschaftsgruppe I zwischen 25.000 € und 50.000 € - je jünger, umso höher. Für alle anderen Angehörigen der Gruppe II beläuft sich der Freibetrag auf 25.000 €. Für die Gruppe III (beide Untergruppen) sinkt der Freibetrag auf 8.000 € ab und für die Gruppe IV auf 1.000 €.
Darüber hinaus gehende Freibeträge sind nur für Sonderfälle vorgesehen, u.a. für Erben mit Behinderungen, für Lebensversicherungen, für die Übertragung der Hauptwohnsitzimmobilie sowie eines Betriebs, jeweils unter bestimmten Voraussetzungen. Der Hausrat wird generell mit 3 % des ermittelten Verkehrswerts der gesamten Erbmasse angesetzt und dem Wert der Erbschaft zugerechnet, unabhängig davon, ob Immobilien im Eigentum gestanden haben oder nicht. Wird Nießbrauch übertragen, so wird der Wert des Hausrates der gesamten Immobilie hinzugerechnet, während dem bloßen Eigentum kein Hausrat hinzugerechnet wird. Im Fall eines Vermächtnisses wird generell kein Hausrat hinzugerechnet.
Besteuerung von Nichtresidenten
Bei Nichtresidenten beschränkt sich die spanische Erbschaftsteuer auf alle in Spanien befindlichen Güter und Rechte. Zu beachten ist diesbezüglich der Unterschied zur Vermögensteuer, die gemäß Doppelbesteuerungsabkommen für deutsche Steuerbürger nur auf spanische Immobilien anfällt, nicht jedoch auf anderes spanisches Vermögen. Beispielsweise wird auch eine Forderung gegenüber einer spanischen Person oder Körperschaft (z.B. ein Gesellschafterdarlehen) als in Spanien befindliches bzw. ausübbares Recht angesehen und unterliegt somit der spanischen Erbschaftsteuer. Die Frage der Belegenheit ergibt sich selbst bei mobilen Gütern, wie z.B. einer Yacht – sofern in Spanien gemeldet, mit spanischem Heimathafen oder hauptsächlich in spanischen Gewässern unterwegs, würde das Schiff ebenfalls als „spanisches Vermögen“ eingestuft.
Der oben erwähnte Hausrat (3 %) wird im Fall von Nichtresidenten nur hinzugerechnet, wenn sich eine Immobilie in der Erbmasse befindet, dann jedoch auf die Gesamtheit des spanischen Nachlassvermögens, nicht nur auf den Wert der Immobilie. Dies schließt auch indirekt (d.h. über eine Firmenstruktur) gehaltene Immobilien mit ein.
Bis einschließlich 2014 waren für Nichtresidenten die staatlichen Steuertabellen maßgeblich. Aufgrund eines Urteils des EU-Höchstgerichts vom 02. September 2014 trat in Spanien per 2015 eine Gesetzesreform in Kraft, der zufolge Nichtresidenten wahlweise die erbschaftsteuerlichen Regelungen jener Region in Anspruch nehmen können, in der sich der Großteil der geerbten Güter und Rechte befindet. Speziell für das Erben von Immobilieneigentum auf den Balearen ergab sich somit die Möglichkeit, insbesondere die im Vergleich mit der staatlichen Regelung wesentlich günstigeren Steuersätze für die Angehörigen der Verwandtschaftsgruppen I und II zu nutzen.
Galt diese Verbesserung zunächst nur für EU-Bürger, erlaubte ein Grundsatzurteil des Spanischen Höchstgerichts vom 19. Februar 2018 die Nutzung der Neuregelung auch Ansässigen von Nicht-EU-Staaten wie z.B. Schweizern. Das bedeutet, dass nunmehr alle Nichtresidenten wahlweise das Erbschaftsteuergesetz „ihrer“ Region anwenden dürfen. Dies wiederum bedingt, dass in jedem Fall ein Vergleich zwischen der staatlichen und der regionalen Regelung stattfinden muss, um die ideale Vorgangsweise zu ermitteln.
Ermittlung des Vorvermögens
Nachdem das Vorvermögen einen Faktor bei der Ermittlung des Steuerbetrags darstellt, ein kurzer Exkurs dazu: Das Vorvermögen wird nach den Bestimmungen der Vermögensteuer festgestellt. Dies kann u.a. bei Immobilien erhebliche Auswirkungen haben, da der Vermögensteuerwert einer Immobilie erheblich unter dem aktuellen Verkehrswert liegen kann.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die steuerliche Bewertung von Immobilien ein verwirrendes Thema sein kann, da praktisch für jede Steuerart ein eigenes Bewertungsverfahren vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang sei auch auf die speziellen Bewertungsmethoden für Beteiligungen an nicht börsengehandelten Gesellschaften hingewiesen. Nicht in das Vorvermögen eingerechnet werden Vermögenswerte, die der Erbe vom Erblasser zu dessen Lebzeiten auf dem Weg einer Schenkung erhalten hat, sofern dafür Schenkungsteuer bezahlt wurde. Bei Nichtresidenten wird lediglich das in Spanien belegene Vorvermögen berücksichtigt, nicht das gesamthafte.
Das Erben über die Grenzen hinweg bringt sowohl rechtlich wie auch steuerrechtlich zusätzliche Komplexität ins Spiel. Daher ist im Interesse einer optimalen Abwicklung zu empfehlen, in beiden Ländern Berater zu beauftragen, die miteinander kommunizieren können und auch wollen. Im Folgenden machen wir beispielhaft auf drei Aspekte aufmerksam, die bei Erbfällen Deutschland-Spanien Bedeutung erlangen können.
Die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland
Die nur für deutsche Staatsbürger geltende „erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht“ hat zur Folge, dass ein Nachlassvermögen in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird, sobald zumindest einer der Beteiligten (Erblasser oder Erbe) als Inländer gilt.
Die Definition des erbschaftsteuerlichen Inländers wird durch eine Fünf-Jahres-Frist ausgedehnt. In Summe hat diese Frist zur Folge, dass ein Nachlassvermögen unabhängig von der Belegenheit der Vermögenswerte in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt wird, wenn einer der beteiligten deutschen Staatsbürger vor weniger als fünf Jahren aus Deutschland weggezogen ist.
Eine erweiterte beschränkte Steuerpflicht kommt dann zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige kein deutscher Staatsangehöriger ist, jedoch zumindest fünf der zehn dem Wegzug vorausgegangenen Jahre in Deutschland verbracht hat.
Die Anrechnung ausländischer Erbschaftsteuer
Nur wenige Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) enthalten Regelungen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer. Auch das DBA Spanien-Deutschland beschränkt sich auf die Vermeidung der doppelten Besteuerung in den Bereichen Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer, weshalb zwischen diesen Ländern kein Mechanismus zur Vermeidung einer doppelten Besteuerung von Erbschaft und Schenkung vereinbart ist.
Jedoch enthalten die nationalen Steuergesetze beider Länder Regelungen, wonach im Ausland bezahlte Steuer grundsätzlich anrechenbar ist. Der Anrechnung ist in beiden Ländern auf die Höhe der Steuer beschränkt, die im jeweils anderen Land anteilig für das ausländische Vermögen angefallen wäre.
Sollte z.B. in Spanien das Vermögen höher besteuert werden, besteht in Deutschland ein so genannter Anrechnungsüberhang und es erfolgt keine Rückerstattung. Dazu ein Rechenbeispiel aus den bundesdeutschen Erbschaftsteuer-Richtlinien, das im Speziellen die Einschränkung der Anrechnung demonstriert:
Der Erblasser E wird von seinem Sohn S allein beerbt. E hinterlässt Kapitalvermögen im Wert von 500.000 €, ein von ihm selbst genutztes Familienheim (die Wohnfläche beträgt unter 200 m2) mit einem Grundbesitzwert von 300.000 €, in das S unverzüglich einzieht, und ein Geschäftsgrundstück in Spanien mit einem gemeinen Wert von 150.000 €. Auf dem Grundstück in Spanien lasten Grundschulden mit einer Valuta von 50.000 €. S wird in Spanien zu einer Erbschaftsteuer von 20.000 € herangezogen.
| Inländisches Familienheim | 300.000,00 € |
| Befreiung nach §13 I 4c ErbStG | - 300.000,00 € |
| Zwischenergebnis | 0,00 € |
| Grundstück in Spanien | 150.000,00 € |
| Kapitalvermögen | 500.000,00 € |
| Gesamter Vermögensanfall | 650.000,00 € |
| Nachlassverbindlichkeit (Grundschuld in Spanien) | - 50.000,00 € |
| Steuerpflichtiges Gesamtvermögen | 600.000,00 € |
| Erbfallkostenpauschale | - 10.300,00 € |
| Persönlicher Freibetrag | - 400.000,00 € |
| Steuerpflichtiger Erwerb | 189.700,00 € |
| Steuersatz 11% Steuerbetrag | 20.867,00 € |
| Ausländische Steuer | 20.000,00 € |
| Abzugsfähiger Anteil gem. §21I2 ErbStG Steuer vor Anrechnung x steuerpflichtiges Auslandsvermögen ------------------------------------------------------------------------------------ steuerpflichtiges Gesamtvermögen | |
| Grundstück in Spanien | 150.000,00 € |
| Direkt zuzuordnende Grundschulden | - 50.000,00 € |
| Steuerpflichtiges Auslandsvermögen | 100.000,00 € |
| Festzusetzende Erbschaftsteuer 20.867,00 € - 3.478,00 € | 17.389,00 € |
Effektive doppelte Besteuerung von Bankkonten
Die effektive doppelte Besteuerung von Bankkonten ohne die Möglichkeit einer Anrechnung findet nur statt, wenn ein in Deutschland Erbschaftsteuerpflichtiger ein Bankguthaben in Spanien erbt (nicht im umgekehrten Fall). Dieser Umstand ist auf den Unterschied hinsichtlich der Einstufung der Belegenheit von Bankkonten zurückzuführen: Für das deutsche Finanzamt ist Geld, egal wo es liegt, stets deutsches Inlandsvermögen. Das spanische Finanzamt hingegen betrachtet im Ausland liegendes Geld als Auslandsvermögen und lediglich die auf spanischen Konten liegenden Beträge als Inlandsvermögen. Ein bis zum Europäischen Gerichthof ausgefochtener Fall hat in ein Grundsatzurteil gemündet, das die Rechtmäßigkeit der in diesem Fall effektiven doppelten Besteuerung bestätigt (Rechtssache C-67/08, Block).
Rechtliche Abwicklung
Für Residenten stellt sich die rechtliche Abwicklung vergleichsweise einfach dar, obwohl ein ausländisches Testament einen erhöhten administrativen Aufwand bedingt, da bei der Anwendung ausländischen Erbrechts u.a. die Testamentseröffnung oder der Gerichtsentscheid über die Erbfolge dem spanischen Notar mit Apostille und beeideter Übersetzung vorgelegt werden muss. Gilt spanisches bzw. das entsprechende regionale Erbrecht, so sind die entsprechenden Unterlagen seit einer Rechtsreform nicht mehr einem Nachlassgericht, sondern ebenfalls dem Notar vorzulegen, der somit zu einer zentralen Instanz der rechtlichen Abwicklung wird. Zweck des Notartermins ist in beiden Fällen eine Urkunde über die Erbschaftsannahme. Diese Urkunde ist anschließend die Grundlage für die Umschreibung der vererbten Güter und Rechte zugunsten der neuen Eigentümer.
Für Nichtresidenten stellt sich die Situation komplexer dar. Insbesondere sollte man die erforderlichen Schritte so rasch als möglich einleiten. Die a priori geltende Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt des Todes erscheint eine ausreichend lange Zeit zu sein, um die nötigen Dokumente zu besorgen und Schritte abzuwickeln. Jedoch ist zu bedenken, dass manche Teilverfahren mehr als einen Monat in Anspruch nehmen können. Im Folgenden eine Darstellung, die auf unseren Praxiserfahrungen beruht.
Der wichtigste Punkt zum Einstieg ist die Prüfung, ob alle Erben über eine NIE (spanische Identifizierungsnummer für Ausländer) verfügen. Erst mit einer solchen wird der Erbe in Spanien geschäftsfähig und kann den Notartermin zur Erbschaftsannahme wahrnehmen. Da die zuständigen Behörden oft überlastet sind und die Terminvergabe einem notorisch kapriziösen Online-System unterliegt, kann die Wartezeit bis zum Termin der Antragstellung zeitweise bis zu einem Monat oder mehr betragen. Eine Antragstellung durch Dritte erfordert eine notarielle Vollmacht, was neuerlich einen Vorlauf bewirkt.
Zu beachten: Eine NIE und damit verbundene Anmeldung beim Finanzamt ist bereits für einen allfälligen Antrag auf Fristverlängerung für die Erbschaftsteuererklärung erforderlich (s. auch folgender Abschnitt).
Für den Notartermin, bei dem die Annahme der in Spanien gelegenen Vermögenswerte (meist Immobilien) durch die ausländischen Erben beurkundet wird, benötigt der Notar die geeigneten Dokumente, um eindeutig festzustellen, dass der Betroffene tatsächlich der rechtmäßige Erbe ist.
Daher die Notwendigkeit amtlicher Dokumente, die erst mit der Apostille in Spanien anerkannt werden. Sofern der Notar der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wird auch eine beeidete Übersetzung nötig. Für den weiteren Verlauf des Verfahrens sind jedoch in jedem Fall Übersetzungen nötig bzw. empfehlenswert.
Zu den erforderlichen Dokumenten gehört u.a. ein Totenschein, mit dem das Vorliegen des Erbfalls belegt wird, sowie Dokumente, welche die amtlich anerkannte Verteilung des Nachlassvermögens belegen, u.a. eine Bescheinigung des zentralen spanischen Testamentsregisters. Bei Immobilien sind Dokumente vorzulegen, welche die Inhaberschaft des Erblassers beweisen. Bei Bankkonten muss eine spezielle Bescheinigung über den oder die Konto- und Depotsalden zum Todeszeitpunkt abgefragt werden. Auch diese Abfrage kann sich je nach Bank fallweise länger hinziehen.
Zwar wurden mit der neuen EU-Erbrechtsverordnung (2015) auch neue europaweit gültige Dokumente ins Leben gerufen, wie z.B. das europäische Nachlasszeugnis, womit man sich die Apostille und in manchen Fällen auch die beeidete Übersetzung sparen kann, doch lösen diese Formulare oft neue Probleme aus, weil manche Bearbeiter wenig oder keine Erfahrung mit der korrekten Bearbeitung haben. Wenn alles erledigt und die notarielle Urkunde über die Erbschaftsannahme erstellt ist, müssen die entsprechenden Erbschaftsteuererklärungen eingereicht werden. Erst nach Vorlage der Bestätigung über die Deklaration und Steuerzahlung werden die zuständigen Stellen die Umschreibung vornehmen, z.B. das Grundbuchamt im Fall einer geerbten Immobilie. Die Probleme, die sich u.a. durch ein sich hinziehendes Erbschaftsverfahren im Ausland im Hinblick auf die spanischen Fristen ergeben können, behandeln wir im folgenden Abschnitt.
Fristen und Vorgaben für die Steuererklärung
In Spanien wird die Erbschaftsteuer bis spätestens sechs Monate nach dem Datum des Ablebens fällig, und zwar in Form der Einreichung des Formulars „Modelo 650“. Ist absehbar, dass diese Frist aus welchen Gründen immer nicht eingehalten werden kann, besteht die Möglichkeit, bis spätestens zum Ende des fünften Monats eine Verlängerung der gesamten Frist auf ein Jahr zu beantragen.
Wird die Erklärung bei positivem Bescheid nach Ablauf der sechs Monate, jedoch vor Ablauf eines Jahres eingereicht, dann wird auf die Steuersumme kein Säumniszuschlag berechnet, die Zahllast erhöht sich lediglich um den gesetzlichen Zins.
Nun kann es vorkommen, dass aufgrund eines sich im Ausland länger hinziehenden Verfahrens eine Einreichung binnen eines Jahres ebenfalls nicht möglich ist. Sobald sich das abzeichnet, müssen die potenziellen Erben einen entsprechenden Antrag auf unbefristete Fristverlängerung stellen und den angeführten Sachverhalt mit Dokumenten belegen. Dies kann speziell ausländische Steuerpflichtige, die als Nichtresidenten erbschaftsteuerpflichtig werden, vor eine Herausforderung stellen, da fremdsprachige Unterlagen für die Behörde aufzubereiten sind. Die generelle Empfehlung lautet, Schlüsseldokumente beeidet übersetzen zu lassen.
Beantwortet das Finanzamt den Antrag positiv, so hat das zur Folge, dass für die Dauer des Aufschubs auch die Verjährungsuhr zu ticken aufhört. In jedem Fall will die Steuerbehörde in einem solchen Fall auch genau wissen, um welche Güter und/ oder Rechte es sich handelt. Das heißt, die Behörde möchte den Erbvorgang dann detailliert auf dem Radar haben.
Werden alle diese formellen Anforderungen nicht oder zu spät erfüllt, bleibt nur noch die Möglichkeit, die im provisorischen Bescheid über Säumnisaufschlag und -zinsen vorgesehenen Einsprüche vorzubringen. Das Finanzamt entscheidet über diese von Fall zu Fall. Jedoch ist die Verhandlungsposition für den Steuerpflichtigen naturgemäß keine gute.
Wichtig: Anders als bei den meisten anderen Deklarationen ist bei der Erbschaftsteuererklärung – zu deklarieren mit dem so genannten „Modelo 650“ – die Einreichung aller Unterlagen erforderlich, auf denen der Vorgang der Erbschaft und die Berechnung der Erbschaftsteuer beruhen. Dasselbe gilt auch für die Schenkungsteuer („Modelo 651“). Für Nichtresidenten ist zu beachten, dass auch bei Anwendung von regionalen Steuergesetzen die Einreichung der Deklaration an das staatliche Finanzamt (AEAT) erfolgt. Residenten reichen die Erklärung beim Finanzamt ihrer Region und in jedem Fall gemäß deren Steuergesetzen ein (auf den Balearen: ATIB). Die staatlichen und regionalen Steuerbehörden stehen zwar im Kontakt, sind jedoch strikt unabhängig voneinander organisiert und arbeiten auch getrennt.
Das neue europäische Erbrecht
Mit der neuen EU-Erbrechtsverordnung ist am 17. August 2015 ein neues Regelwerk mit erheblichen Auswirkungen in Kraft getreten, das in allen EU-Ländern außer Dänemark und Irland gilt. Bis zu diesem Zeitpunkt war für die Frage, welches Erbrecht beim Ableben eines EU-Bürgers zur Anwendung kommt, die jeweilige Staatszugehörigkeit maßgebend. Das neue EU-Erbrecht stellt den Wohnsitzstaat in den Mittelpunkt. Demzufolge kommt z.B. für einen Deutschen, der auf Mallorca ansässig ist und hier verstirbt, a priori das mallorquinische Erbrecht (Foralrecht) zur Anwendung, um darüber zu entscheiden, wer was erbt bzw. ob ein ggfs. errichtetes Testament im Einklang mit diesem Recht steht und daher Gültigkeit hat.
Jedoch hat der Wohnsitz im Ausland den Vorteil, dass nunmehr eine Rechtswahl möglich ist. D.h. ein nach Spanien umgezogener Deutscher kann wahlweise verfügen, dass das Erbrecht seiner Staatszugehörigkeit zur Anwendung kommen soll. Dies kann durch einen Zusatz im Testament oder eine gesonderte notarielle Urkunde erfolgen. Im Vorfeld empfiehlt sich eine Beratung darüber, welches Erbrecht im Sinne der gewünschten Erbfolge das geeignetere ist. Z.B. wäre ein gemeinsamer letzter Wille in der Art des Berliner Testaments nur in Deutschland möglich, weil das spanische Erbrecht keine gemeinsamen Testamente erlaubt. Umgekehrt können Pflichtteilsbestimmungen je nach Zielsetzung ein Testament in Spanien ratsam erscheinen lassen.
Besonderheiten des spanischen Erbrechts
Die prägende Besonderheit des spanischen Erbrechtes ist der Umstand, dass es keine einheitliche Gesetzgebung für ganz Spanien gibt. Zu unterscheiden ist zwischen Regionen, in denen das Bürgerliche Gesetzbuch gilt (der sogenannte Código Civil), und anderen, in denen Foralrecht gilt, d.h. regionales Recht. Beispiele: In Andalusien gilt das Erbrecht des spanischen Bürgerlichen Gesetzbuches, in Katalonien das katalanische Erbrecht. Auf den Balearen ist die Situation noch ein Stück komplizierter, da hier sogar einzelne Inseln ihr eigenes Erbrecht haben, nämlich Mallorca, Menorca und die Pityusen (Ibiza und Formentera).
Allgemeines
Der „pacto sucesorio“ (Nachfolgepakt) stellt im Grunde ein Zwitter aus Erbschaft und Schenkung dar, deshalb behandeln wir das Thema außerhalb der in Erbschaft und Schenkung unterteilten Abschnitte. Diese Modalität ist grundsätzlich nur in Regionen mit eigener Rechtsordnung möglich, denn der Código Civil verbietet diese Übertragungsform ausdrücklich. Die Regionen mit eigener Rechtsordnung, in welcher der „pacto sucesorio“ vorgesehen ist, sind das Baskenland, Katalonien, Galizien sowie die vier Balearen-Inseln: Mallorca, Ibiza, Formentera und – seit einer Gesetzesreform 2017 – auch Menorca (identisch wie Mallorca, jedoch nur mit der Modalität der „Donación con Definición“).
Was ist ein „pacto sucesorio“? Es handelt sich um einen Vertrag zwischen zwei mündigen Bürgern, in dem einer dem anderen auf dem Weg einer vorgezogenen Erbschaft einen Teil seines Vermögens überträgt. Der Empfänger muss sich dafür zu einer Gegenleistung verpflichten. In den zwei mallorquinischen Modalitäten des Nachfolgepakts besteht diese Gegenleistung entweder in der Verpflichtung zur Annahme der Erbschaft oder im ausdrücklichen Verzicht auf den zustehenden Pflichtteil.
Nachdem der Pacto Sucesorio steuerlich gesehen lange Jahre im Dornröschenschlaf gelegen und wenig Beachtung gefunden hatte, sorgte ein Urteil eines galizischen Höchstgerichts vom 9. Februar 2016 für ein Erdbeben. Denn die Richter befanden, dass die Finanzbehörde den Nachfolgepakt wie eine Erbschaft zu behandeln hatte, obwohl der Anlass kein Sterbefall ist, sondern eine Übertragung zu Lebzeiten. Das bedeutet einerseits die Anwendung von Erbschaftsteuersätzen, die je nach Region und Verwandtschaftsverhältnis wesentlich vorteilhafter sein können als Schenkungsteuer (Beispiel: Balearen). Aber andererseits – und hier liegt der wesentliche Vorteil – verzichtet der Staat bei einer Erbschaft ausdrücklich auf eine Besteuerung des Wertzuwachses des übertragenen Guts.
Speziell bei Gesellschaftsanteilen und Immobilien hat sich somit ein wahres Scheunentor aufgetan, um stille Reserven völlig legal am Fiskus vorbeizuschleusen. Auf den Balearen nutzten zahlreiche Familien die Gelegenheit, um Immobilien, die vor langer Zeit erworben wurden und daher einen steuerlich brisanten Wertzuwachs bergen, kurz vor dem Verkauf zu übertragen, meist an die – notwendigerweise volljährigen – Kinder. Im Rahmen eines Nachfolgepaktes bezahlen diese jeweils nur die geringe balearische Erbschaftsteuer (im Idealfall 1 % bis 700.000 €), während der in der Erbschaftsteuer deklarierte Wert zugleich der Anschaffungswert für die Berechnung des Gewinns aus dem folgenden Verkauf ist. D.h. anders als bei der Schenkung muss der Übertragende für den Wertzuwachs des übertragenen Gutes keine Einkommensteuer bezahlen.
Der Nachfolgepakt hat jedoch noch weitere Vorteile:
- Steuerlich „stirbt“ der Erblasser zweimal, d.h. speziell bei umfangreichen Erbschaften kann durch die Aufteilung auf zwei Erbschaftsvorgänge die Progression wesentlich gemindert werden.
- Durch die Aufteilung des Vermögens kann auch die Vermögensteuerbelastung für eine Familie gesamthaft gemindert werden (Nutzung von mehreren Freibeträgen, geringere Progression).
- Unternehmer können zu Lebzeiten eine geordnete Übergabe ihrer Firma zu den steuerlichen Bedingung vornehmen und begleiten. Das hilft auch, Rechtsstreitigkeiten unter Erben zu vermeiden.
Zum Teil ist diese Tür zum Steuersparen durch die „kleine Reform“ im Juli 2021 geschlossen worden. Der Gesetzgeber in Madrid hat das Einkommensteuergesetz dahingehend reformiert, dass seither der Wertzuwachs zwischen Erwerb und Übertragung per Nachfolgepakt nur dann steuerfrei bleibt, wenn der Übertragende tatsächlich bereits verstorben ist oder mindestens fünf Jahre vergangen sind. Diese Neuregelung gilt jedoch nicht rückwirkend, d.h. die bis Juli 2021 in dieser Weise umgesetzten Übertragungen sind über diesen Weg nicht mehr angreifbar.
Nachfolgepakt auf den Balearen
Mallorca
Auf Mallorca sind zwei Modalitäten des Nachfolgepaktes vorgesehen: die sogenannte „Donación universal“ und die „Donación con definición“. Wie bei allen Nachfolgepakten handelt es sich auch hier um unwiderrufliche notarielle Vereinbarungen zwischen geschäftsfähigen Parteien. Damit unterscheidet sich der Nachfolgepakt wesentlich von der Schenkung, die auch an Minderjährige erfolgen kann.
Donación universal“ Der Schenker überträgt eine Serie von Gütern und der Beschenkte erwirbt im Rahmen dieser Vereinbarung den Status eines vertragsmäßigen Erben. Das bedeutet einerseits, dass mit diesem Dokument jegliches vorher errichtete Testament ungültig wird, und andererseits, dass der Beschenkte beim Ableben des Schenkers die Erbschaft nicht ausschlagen kann. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine möglicherweise problematische bzw. belastete Erbmasse zu berücksichtigen.
Der Beschenkte muss geschäftsfähig sein. Da es sich um einen Vertrag mit Gegenleistung handelt, kann dieser nicht durch einen Vormund für einen Minderjährigen abgeschlossen werden. Andererseits muss der Beschenkte mit dem Schenker nicht verwandt sein. Ansässigkeit und Staatsangehörigkeit des Beschenkten haben keine Bedeutung. Dem Gesetzestext nach muss jedoch der Schenker den balearischen Bürgerstatus („vecindad balear“) haben, was die spanische Staatsbürgerschaft voraussetzt. Doch darauf gehen wir unter dem Punkt „Problemstellungen für Ausländer“ noch einmal gesondert ein.
Im Rahmen einer „donación universal“ können mehrere Erben beschenkt werden. Doch ist dieser Akt einmal durchgeführt, kann kein weiterer Nachfolgepakt abgeschlossen und können somit keine weiteren Erben bestellt werden. Auch kann danach kein weiteres Testament errichtet werden, sondern lediglich ein Vermächtnis.
„Donación con definición“ Bei diesem Nachfolgepakt muss der Beschenkte ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling des Schenkers sein, da seine vertragliche Gegenleistung darin besteht, auf seinen Pflichtteil oder generell auf seine Nachfolgerechte oder aber auf beides zu verzichten.
Der balearische Bürgerstatus ist für den Beschenkten keine Voraussetzung.
Der Pflichtteil wird nach Maßgabe des Vermögensstandes zum Zeitpunkt der Schenkung berechnet, spätere Änderungen des Vermögens werden in diesem Rechtsgeschäft nicht mehr berücksichtigt.
Im Unterschied zur „donación universal“ wird hier ein vorher gemachtes Testament nicht ungültig, jedoch wird die Erbenbestellung verändert.
Ibiza und Formentera
Auf diesen beiden Inseln – auch Pityusen genannt – nennt sich der Nachfolgepakt „pacto de institución“. Hier bestehen ebenfalls zwei Modalitäten mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten:
Die „donación singular“ oder „donación universal“ ermöglicht die Übertragung als Vermächtnis oder Erbe. Der Beschenkte muss im Unterschied zum Schenker keinen pityusischen Bürgerstatus („vecindad pitiusa“) aufweisen und mit dem Schenker auch nicht verwandt sein.
Die zweite Modalität, genannt „finiquito de legitima“, erfordert vom Schenker, ein pflichtteilsberechtigter Abkömmling zu sein. Der pityusische Bürgerstatus ist nicht erforderlich.
Menorca
Nachdem die menorquinische Gesetzgebung den Nachfolgepakt bis 2017 ausschloss, ist dieses Rechtsinstrument nach einer Reform auch für die Bewohner der Nachbarinsel Mallorcas eine mögliche Übertragungsoption, allerdings nur in Form der „donación con definición“, die identisch geregelt ist wie auf Mallorca (s. oben).
Problemstellungen für Ausländer
Residenten mit ausländischer Staatsangehörigkeit
Wie bereits erwähnt, wird von den insularen Gesetzgebungen Mallorcas und der Pityusen für den Schenker jeweils der balearische Bürgerstatus verlangt, der seinerseits die spanische Staatsangehörigkeit zur unbedingten Voraussetzung hat. Auf den ersten Blick schließt diese Bedingung alle Mallorca-, Ibiza- und Formentera-Residenten mit ausländischer Staatsangehörigkeit vom Nachfolgepakt aus.
Jedoch hat bereits ein Jahr nach dem anfangs erwähnten Galizien-Urteil die balearische Steuerbehörde ATIB in einer internen Dienstanweisung festgestellt, dass sie auf Basis des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung von EU-Ausländern den „pacto sucesorio“ auch bei ausländischen Residenten akzeptiert und steuerlich die Schenkung entsprechend als Erbschaft behandelt, sofern alle sonstigen formellen Voraussetzungen erfüllt werden.
Leider sind damit nicht alle Probleme gelöst. Anfangs haben nicht alle, aber doch zahlreiche und vor allem angesehene Notare aufgrund des Wortlauts der insularen Gesetzgebung auf der Voraussetzung des balearischen Bürgerstatus beharrt und keine Urkunde für einen Nachfolgepakt unterschrieben, wenn beim Schenker keine „vecindad balear“ vorliegt, da sie das Rechtsgeschäft als nicht ausreichend abgesichert betrachten.
Im Herbst 2019 hat die balearische Notarkammer eine entsprechende Anweisung gegeben, womit ab diesem Zeitpunkt theoretisch kein Notar mehr einen „pacto sucesorio“ für Ausländer aufsetzen konnte.
Die bislang letzte Wendung hat das Thema am vorletzten Tag des Jahres 2020 mit einem Urteil des regionalen balearischen Gerichts genommen. Diesem zufolge ist der Nachfolgepakt für ausländische Residenten zulässig. Damit sollte die Rechtsunsicherheit beendet sein.
Wichtige Anmerkungen:
A) Nicht alle Begünstigungen der Erbschaftsteuer funktionieren auch mit dem Nachfolgepakt. Der Freibetrag von 95 % bei der Übertragung von Familienbetrieben wurde im Jahr 2020 gleich von drei verbindlichen Auskünften versenkt. Die Behörde erachtet den Tod des Übertragenden als unbedingte Voraussetzung.
B) Wenn er denn funktioniert, so tut dies der Nachfolgepakt nur für hier ansässige Angehörige eines Staates, der sich der seit August 2015 geltenden neuen EU-Erbrechtsverordnung angeschlossen hat. Das bedeutet: alle EU-Staaten mit Ausnahme von Dänemark und Irland.
Nichtresidenten
Der Nachfolgepakt für Nichtresidenten wird von einigen Büros der Insel als Steuersparmodell angepriesen und auch umgesetzt. Aus unserer aktuellen Sicht ist ein solcher Vorgang mit erheblichen Risiken befrachtet. Zunächst gründet der „pacto sucesorio“ ja darauf, dass der Betroffene das mallorquinische Erbrecht anwendet. Dazu muss er nach der neuen europäischen Erbrechtsverordnung zumindest Resident sein. Somit wird eine grundsätzliche Voraussetzung für die Anwendung des „pacto sucesorio“ nicht erfüllt.
Daher steht zu befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit oder des Glücks ist, wann bzw. ob die staatliche Steuerbehörde AEAT die entsprechend eingereichten Erbschaftsteuererklärungen mit der balearischen Steuerbehörde abgleicht und die Nachversteuerung als Schenkung einfordert. Speziell bei Immobilien mit hohem Wertzuwachs zwischen Erwerb und Schenkung raten wir davon ab, dieses Risiko einzugehen, obwohl die Verjährungsfrist in Spanien mit vier Jahren relativ kurz ist.
Aus unserer Sicht wäre nur eine Fallannahme denkbar, in der ein Nichtresident die steuerliche Behandlung einer Übertragung als Nachfolgepakt in Anspruch nehmen und ggfs. erstreiten kann: Wenn der Ansässigkeitsstaat eine äquivalente Übertragungsform kennt und diese in einer Weise angewendet wurde, die von der spanischen Behörde als gleichwertig anerkannt wird.
Ein solches Rechtsinstrument wäre beispielsweise die in Deutschland mögliche Schenkung unter Pflichtteilsverzicht. Diese kann in einer Weise aufgesetzt werden, dass sie der mallorquinischen „donación con definición“ entspricht.
Aus der Praxis hat sich jedoch ergeben, dass der nötige Pflichtteilsverzicht in den meisten Fällen nicht gewünscht ist. Ebenso ist der Kreis der Schenkungsempfänger auf direkte volljährige Nachkommen beschränkt. Dazu kommt eine weiterhin bestehende Rechtsunsicherheit bzgl. der Anerkennung dieses Übertragungsmodells unter Nichtresidenten.
Unterschiedliche Verjährungsnormen
Die Erbschaftsteuer verjährt vier Jahre nach dem Ende der Deklarationsfrist, d.h. effektiv viereinhalb Jahre nach dem Todeszeitpunkt. Anders verhält es sich mit der Schenkungsteuer. Diese verjährt zwar ebenfalls vier Jahre nach dem Ende der Deklarationspflicht, doch die Verjährungsuhr beginnt nicht mit dem Zeitpunkt der Schenkung zu ticken, sondern erst zu dem Moment, da eine spanische Behörde vom Schenkungsvorgang Kenntnis erlangt.
Beispiel: Ein spanischer Resident erhält im Ausland eine Immobilie geschenkt und behält diesen Umstand für sich (mit den entsprechenden weiteren Risiken im Hinblick auf die Einkommen- und Vermögensteuer sowie die Auslandsvermögenserklärung „Modelo 720“).
Solange keine spanische Behörde davon Kenntnis erlangt, bleibt der Vorgang steuerlich latent. Ab dem Zeitpunkt, da die Schenkung amtlich bekannt wird, hat das Finanzamt vier Jahre Zeit, um dem Betreffenden auf die Finger zu klopfen und eine Nachzahlung der Schenkungsteuer zu fordern.
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wann genau die Behörden als verständigt gelten. Mehrere verbindliche Auskünfte zu diesem Thema stellen fest, dass ein Dokument über die Schenkung in einem öffentlichen Register eingeschrieben oder aufgenommen oder aber einem Beamten der öffentlichen Verwaltung im Rahmen seiner Amtstätigkeit übergeben werden muss. Es reicht also z.B. nicht aus, die im Ausland per Schenkung erhaltene Immobilie in der Auslandsvermögenserklärung oder der Vermögensteuererklärung zu deklarieren, um die Verjährungsuhr in Gang zu setzen, da die Schenkung als solche mit diesem Akt nicht offiziell mitgeteilt und auch kein entsprechendes Dokument übergeben wird.
Säumniszuschläge, Strafen und Zinsen
Anzuwenden sind die Strafregelungen des allgemeinen Steuergesetzes. Zu unterscheiden ist zwischen einer freiwilligen Nacherklärung oder berichtigenden Erklärung außerhalb der regulären Frist einerseits (das spanische Äquivalent zur „Selbstanzeige“) und andererseits einem vom Finanzamt in Gang gesetzten Verfahren.
Im erstgenannten Fall wird nach Maßgabe der Fristüberschreitung ein Säumniszuschlag gemäß der folgenden Tabelle fällig, die im Juli 2021 wesentlich modifiziert wurde. In der Praxis verringert sich der Säumniszuschlag unter leicht erfüllbaren Bedingungen um
25 %, daher der in Klammer genannte Prozentsatz.
| Verspätung ab Ende Einreichungsfrist | Säumniszuschlag % von Steuer- oder Differenzbetrag |
| 1. -3. Monat | 5 % (3,75 %) |
| 4. -6. Monat | 10 % (7,50 %) |
| 7. - 12. Monat | 15 % (11,25 %) |
| Danach | 20 % (15 %) |
Ab einer Fristüberschreitung von einem Jahr wird darüber hinaus ein tagesgenau ermittelter Säumniszins gemäß dem offiziellen Zinssatz berechnet (für 2019: 3,75 % p.a.).
Anders stellt sich die Situation dar, wenn der Steuerpflichtige nicht selbst die Initiative ergreift, sondern das Finanzamt feststellt, dass eine fällige Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung nicht eingereicht wurde oder inkorrekte Angaben enthält. Verhängt werden dann Strafen von 50 % bis 150 % auf den säumigen Betrag. Diese Strafzahlung kann sich in der Praxis unter günstigen Voraussetzungen auf 26,25 % bis 78,75 % verringern. Ebenfalls fällig werden Säumniszinsen, die jedoch anders als bei der freiwilligen Nacherklärung bereits ab dem Ende der Einreichungsfrist berechnet werden.
Ende der Diskriminierung für Nicht-EU-Steuerbürger- Der oberste spanische Gerichtshof (Tribunal Supremo) hat am 19. Februar 2018 ein bahnbrechendes Urteil (Nr. 242/2018) im Zusammenhang mit der Anwendung der Vorschriften über Schenkung- und Erbschaftsteuer für Residenten außerhalb der Europäischen Union erlassen. Am Beispiel von Schweizer Steuerbürgern erklären wir die signifikanten Änderungen.
Eine kleines Berechnungsbeispiel soll die Auswirkungen der Diskriminierung verdeutlichen: Bei einer Ferienimmobilie eines Schweizer Residenten mit einem Wert von 4.100.000 € betrug die zahlungsfällige Erbschaftssteuer, wenn der Erbe die Ehefrau oder ein leibliches Kind ist, insgesamt: bis 800.000 € = 199.920 €; für den Restbetrag 4.100.000 € ./. 800.000 € = 3.300.000 € war der Steuersatz von 40,8 % anzuwenden. Somit betrug die gesamte zu zahlende Erbschaftsteuer: 199.920 € + 1.346.400 € = 1.546.320 € (37,7 %)
Ab dem 19. Februar 2018 beträgt die Besteuerung nunmehr noch 530.600 € (12,93 %) zu zahlen. Die Differenz zu der alten Gesetzgebung beträgt somit 1.015.720 €.