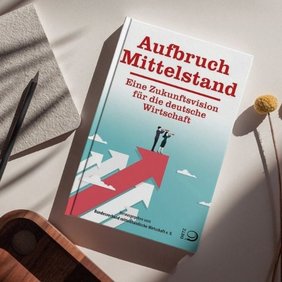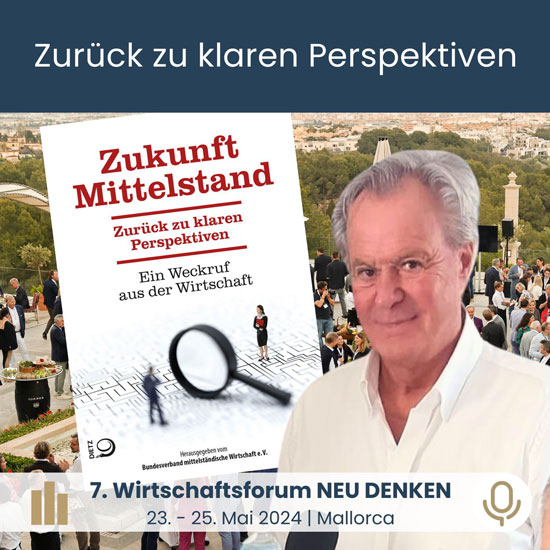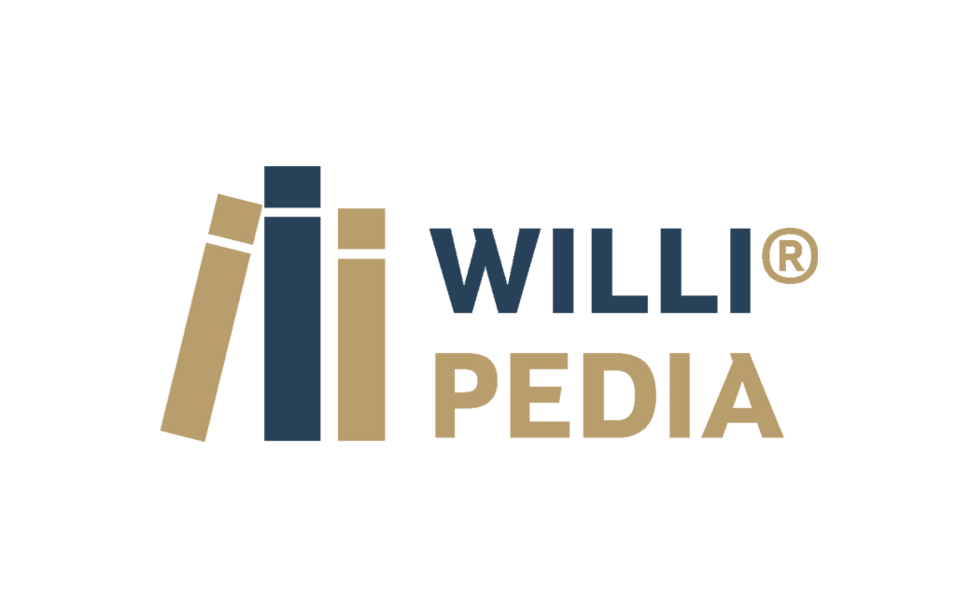Aufbruch Mittelstand: Willi Plattes analysiert in neuem Buchbeitrag die multiplen Herausforderungen
23. Oktober 2025Die deutsche Wirtschaft steht an einem Wendepunkt: Globale Krisen, geopolitische Umbrüche und strukturelle Herausforderungen setzen den Mittelstand unter Druck. In einem Beitrag für einen neuen Sammelband des deutschen Mittelstandsverbands BVMW, der führende Stimmen aus der Branche versammelt, analysiert Willi Plattes die Herausforderungen der globalen Märkte. Erschienen ist das Buch unter dem Titel “Aufbruch Mittelstand. Eine Zukunftsvision für die deutsche Wirtschaft”.
Der CEO der PlattesGroup setzt sich in einem Essay mit dem Titel “Im globalen Strudel von Autokratie, Überregulierung und Populismus” mit den gegensätzlichen Bewegungen in den USA und Europa auseinander. Während unter Präsident Trump bei der US-Steuerbehörde die Kettensäge angesetzt wird, bekommen die Steuerinspekteure in der Europäischen Union nach und nach mehr Ressourcen und mehr Handhabe.
Diese Gegensätze lassen sich nicht nur ideologisch interpretieren – so wie dies häufig geschieht –, sondern auch als Weckruf an Europa, “das in Lethargie zu versinken droht und nicht die nötigen Konsequenzen aus der Erkenntnis zieht, wie sehr die freiheitliche Demokratie unter Druck geraten ist und wie sehr sie gegenüber autoritären Regimen weltweit an Boden verliert”. Der Beitrag stellt Antworten auf politischer, medialer und wirtschaftlicher Ebene zur Debatte, um dieser gefährlichen Entwicklung wirksam zu begegnen.
Balearen-Repräsentanz seit 2023
Willi Plattes vertritt seit zwei Jahren den deutschen Spitzenverband BVMW auf den Balearen. In ihm sind im Rahmen der deutschen Mittelstandsallianz die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Interessen von rund 30 Branchenverbänden mit mehr als 900.000 Mitgliedern gebündelt.
Mehr als 300 BVMW-Geschäftsstellen im In- und Ausland setzen sich für die im Verband organisierten Unternehmen ein. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind die Bildung von Netzwerken, die Organisation von 2.000 Veranstaltungen im Jahr und die politische Interessenvertretung auf regionaler Ebene sowie in Berlin und Brüssel. Der Bundeswirtschaftssenat (BWS) und die Auslandsrepräsentanten des BVMW kamen im September 2024 auf Mallorca zusammen, um sich unter anderem mit Insel-Unternehmern auszutauschen.
Im globalen Strudel von Autokratie, Überregulierung und Populismus
Der Mittelstand im Spannungsfeld weltweit widersprüchlicher Umwälzungen
Frankfurt/Main, 2025: Juristen, Ökonomen, Datenanalysten – die neue EU-Behörde AMLA hat begonnen, im großen Stil Personal zu rekrutieren. Auf ihrer Website wirbt die Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die gerade aufgebaut wird, für die EU als Arbeitgeber und die Finanzmetropole Frankfurt als Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Bis 2027 soll die Zahl der Mitarbeiter auf über 400 wachsen. Die Aufgaben der neuen Behörde: risikoreiche Finanzunternehmen direkt beaufsichtigen, bei Versagen der Aufsichtsbehörden eingreifen und die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen überwachen. Die vom EU-Parlament im Frühjahr 2024 beschlossenen Vorschriften enthalten zudem die geplante Einführung verschärfter Überwachungsbestimmungen für besonders reiche Personen.
Washington, 2025: Sachbearbeiter, Compliance-Beauftragte, Steuerprüfer speziell für Großunternehmen und internationale Prüfungen – die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) hat unter US-Präsident Donald Trump mit einem umfassenden Personalabbau begonnen. Die Massenentlassungen sollen in mehreren Phasen erfolgen, die Belegschaft von etwa 100.000 auf 50.000 Mitarbeiter schrumpfen. Schätzungen zufolge könnten die Steuereinnahmen des Bundes um bis zu zehn Prozent sinken. Gleichzeitig werden multilaterale Rahmenwerke zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Geldwäsche demontiert.
Gegensätzliche Entwicklungen
Mehr Ressourcen und mehr Handhabe für Steuerinspekteure hier in Europa, ein radikales Sparprogramm und ein Maulkorb für Inspekteure dort in den USA – gegensätzlicher könnten die Entwicklungen diesseits und jenseits des Atlantiks nicht sein. “Donald Trump ist dabei, die Vereinigten Staaten zum größten Steuerparadies der Geschichte zu machen”, urteilt der Wirtschaftsnobelpreisträger, Ökonom und Referent des Wirtschaftsforums NEU DENKEN 2024, Joseph E. Stiglitz, in einem Beitrag für das Onlineportal “The Pioneer”. Umgekehrt könnte die neue Superbehörde in Frankfurt und die geplante EU-weite Erfassung von Vermögenswerten eine neue Ära der Finanzüberwachung in Europa einleiten, die sich nicht auf die Bekämpfung illegaler Praktiken beschränkt – sie könnte auch Grundlage für neue fiskalische Eingriffe sein. Zumal der Finanzierungsbedarf der staatlichen Institutionen in der EU beispielsweise in der Sicherheits- oder der Klimapolitik nicht geringer werden dürfte.
EU-Superbehörde und verschärfte Überwachung in Europa
Der Aufbau der AMLA beruht auf einem Gesetzespaket, welches das Europäische Parlament im April 2024 verabschiedet hatte und das das Instrumentarium der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stärken soll. Es sieht vor, dass Personen mit “berechtigtem Interesse” – einschließlich Journalisten, Organisationen der Zivilgesellschaft, zuständige Behörden und Aufsichtsorgane – sofortigen, ungefilterten und freien Zugang zu den Angaben von “wirtschaftlichen Eigentümern” haben, die in nationalen Registern gespeichert und auf EU-Ebene vernetzt sind. Zusätzlich zu den aktuellen Informationen sollen die Register auch Daten enthalten, die mindestens fünf Jahre zurückreichen, wie das EU-Parlament in einer Pressemitteilung über das verabschiedete Gesetzespaket ausführt.
Die neuen EU-Regeln enthalten demnach auch verschärfte Überwachungsbestimmungen für besonders reiche Personen – genannt ist ein Gesamtvermögen von mindestens 50 Millionen Euro, den Wert des Hauptwohnsitzes nicht mit eingerechnet. Die verabschiedeten Gesetze sehen darüber hinaus verstärkte Kontrollen der Kundenidentität vor. Demnach sind Banken, Verwalter von Vermögenswerten und Kryptoanlagen oder etwa Immobilienmakler verpflichtet, verdächtige Aktivitäten an die zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units, FIU) und andere zuständige Behörden zu melden. Ab 2029 müssen auch Profifußballvereine der obersten Liga, die an Finanztransaktionen mit hohem Wert mit Investoren oder Sponsoren beteiligt sind, die Identität ihrer Kunden überprüfen, Transaktionen überwachen und über verdächtige Transaktionen informieren.
Hinzu kommen eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen außer zwischen Privatpersonen im nichtprofessionellen Bereich sowie auch ein Maßnahmenkatalog, mit dem sichergestellt werden soll, dass Finanzsanktionen auch tatsächlich angewendet werden und Sanktionen nicht vermieden werden können. Dabei kommt der neuen Superbehörde in Frankfurt eine zentrale Rolle zu: Sie soll die Anwendung der Vorschriften und der Sanktionen überwachen, die risikoreichsten Finanzunternehmen direkt beaufsichtigen, bei Versagen der Aufsichtsbehörden eingreifen und als zentrale Drehscheibe für die Aufsichtsbehörden fungieren.
Ein Zentralregister für Vermögenswerte?
Die Pläne der EU reichen aber noch weiter. So wurde im März 2024 eine Machbarkeitsstudie für ein europäisches Vermögensregister veröffentlicht. Dabei geht es im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung um einen einheitlichen Zugangspunkt für Behörden zu relevanten Vermögensregistern in den EU-Mitgliedstaaten. Im Visier stehen Vermögenswerte, die in diesem Kontext häufig eine Rolle spielen – neben Bankkonten, Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Unternehmensbeteiligungen auch Immobilien, Kryptowährungen oder Sachwerte wie Fahrzeuge, Kunstwerke und Edelmetalle. Die Studie stellt fest, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erfassung der Vermögenswerte sowie der Zugänglichkeit der Daten gibt und bewertet drei Szenarien: die Verknüpfung bestehender Vermögensregister der Mitgliedstaaten auf EU-Ebene, die Schaffung und Verknüpfung zusätzlicher Register sowie die Einrichtung eines zentralisierten EU-Registers.
Nicht gegensätzlicher könnte die Entwicklung in den USA sein. Der Personalabbau in der US-Steuerbehörde IRS wurde Anfang April eingeleitet. Allein im Bürgerrechtsbüro der Behörde, das frühere Büro für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration hieß, sollen 75 Prozent gestrichen werden. Insgesamt werden laut den Plänen der Trump-Regierung 20 bis 25 Prozent der Belegschaft entlassen, mehr als 20.000 Beschäftigte. Die Kürzungen sind Teil einer umfassenden Umstrukturierung der Bundesverwaltung, die bereits mehr als 200.000 Mitarbeiter ihren Job gekostet hat.
Generell wird in der öffentlichen Verwaltung des Finanzwesens die Kettensäge angesetzt. “Man beachte den Rückzug des Finanzministeriums aus dem Transparenzsystem, das die Identität von Unternehmenseigentümern offenlegt”, analysiert Ökonom Stiglitz. “Außerdem der Rückzug aus den Verhandlungen über ein internationales UN-Steuerabkommen. Die Weigerung, den Foreign Corrupt Practices Act durchzusetzen. Hinzu kommt die massive Deregulierung von Kryptowährungen.” Stiglitz schreibt von einem Versuch, eine Art Kapitalismus nach dem Vorbild der »gesetzlosen Zonen der Offshore-Welt« zu schmieden.
Analyse statt Ideologie
In Zeiten zunehmender Polarisierung droht auch eine Analyse dieser gegensätzlichen Ansätze in Europa und den USA ins Räderwerk partei- und geopolitischer Ideologien zu geraten. Je nach Standpunkt ist das, was in Europa passiert, ein wichtiger Schritt in Sachen Transparenz, Steuergerechtigkeit und Bekämpfung von Geldwäsche – oder aber die Schaffung eines weiteren bürokratischen Monsters, das einen Überwachungsstaat schafft und den Weg zur Enteignung privater Vermögen ebnen könnte. Und das, was in den USA begonnen hat, lässt sich als schlecht geplante, wenig zielführende und autoritär angefärbte Lobbyarbeit für Trumps milliardenschwere Kumpanen interpretieren – oder auch als konsequente Politik eines Machers, der ermüdenden und am Ende ergebnislosen Debatten über nötige Reformen eine Kettensäge entgegensetzt, mit der er den gordischen Knoten der Bürokratie durchtrennt.
Die Trump-Show ließe sich aber auch noch ganz anders interpretieren: als Weckruf an Europa, das in Lethargie zu versinken droht und nicht die nötigen Konsequenzen aus der Erkenntnis zieht, wie sehr die freiheitliche Demokratie unter Druck geraten ist und wie sehr sie gegenüber autoritären Regimen weltweit an Boden verliert. Der US-Präsident bietet beständig Angriffsfläche – doch auf Trump zu schimpfen und sich an dem Narzissmus des US-Präsidenten mit seinen täglich neuen Vorstößen abzuarbeiten, ist kein Reformansatz, wie er angesichts der riesigen Herausforderungen in den EU-Ländern immer dringender wird.
Und es ist auch kein konstruktiver Beitrag in der öffentlichen Debatte, der dazu beitragen könnte, die Basis der demokratischen Mitte und ihre Handlungsfähigkeit bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu meistern. Im Gegenteil. »Die journalistischen Narrative des Niedergangs und die Horrorszenarien des Populismus sind in ihrer Wirkung aufs Engste miteinander verwandt«, analysiert der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in einem Beitrag für den “Spiegel”. “Sie verstärken in einem zerstörerischen Zusammenspiel die große Gereiztheit, die allgemeine Stimmungslage des Total-Pessimismus und die Sehnsucht nach einfachen, durchschlagenden Lösungen.”
Demokratien auf dem Rückzug
Zunehmende Komplexität, Handlungsunfähigkeit demokratischer Regierungen, Reformversprechen, die nicht eingehalten werden – nicht nur in den USA überlagert der Wunsch nach einfachen Lösungen zunehmend das Prinzip demokratischer Freiheit. Die Regierungsform der Demokratie mit ihren langwierigen Debatten, schwierigen Entscheidungsfindungen und ihren zeitraubenden Kontrollmechanismen ist bekanntlich anstrengend – und immer mehr Menschen verlieren offenbar die Geduld, was nicht nur in den USA, aber dort besonders anschaulich zu beobachten ist. Unzufriedenheit staut sich auf, die Kritik an der etablierten Politik wächst, das Vertrauen in sie schrumpft, und die Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums verzeichnen scheinbar unaufhaltsamen Zulauf.
“Viele Menschen entwickeln daraus – bewusst oder unbewusst – eine wachsende Sehnsucht nach Autokratie, übersehen jedoch die negativen Folgen für Freiheit und Bürgerrechte«, analysiert Dr. Heinz-Werner Rapp, Leiter des FERI Cognitive Finance Institute, in der Studie »Globale Rezession der Freiheit”. Hinzu kommt: Der neue Zeitgeist hin zur Autokratie, der bereits viele westliche Gesellschaften erfasst hat, wird durch Einflüsse von außen noch verstärkt. Autokratische Länder wie Russland oder China agieren gemeinsam gegen das Modell freiheitlicher Demokratien. Auch Indien, die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt, driftet zunehmend in eine Autokratie ab. Nostalgie, Nationalismus und Demokratiefeindlichkeit befeuern sich gegenseitig und ebnen autokratischen Idealen und Systemen den Weg. Gleichzeitig werden wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Freiheiten zurückgedrängt, und das offenbar nachhaltig – eine Entwicklung, die mit einem drohenden »Übergang in ein autoritäres Jahrhundert« beschrieben wird.
Begünstigt wird dies neben den politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen auch durch die technische Entwicklung. Nach der Zurückdrängung eines auf Relevanz, Meinungsvielfalt und Argumenten basierenden öffentlichen Diskurses in den traditionellen Medien zugunsten sozialer Netzwerke, in denen Algorithmen, Filterblasen und Fake News die Wahrnehmung der Realität bestimmen, zeichnen sich durch die anstehende KI-Revolution weitere Verwerfungen ab, die auf Kosten freiheitlicher Prinzipien gehen dürften.
Welche Antworten sind also nötig auf politischer, medialer, wirtschaftlicher Ebene? Nobelpreisträger Stiglitz sieht in dem geopolitischen Ego-Trip der USA auch eine Chance. Die Distanzierung von internationalen Vereinbarungen könne dazu beitragen, multilaterale Verhandlungen in einem anderen Kontext zu stärken – auch gerade vor dem Hintergrund, dass Trump in der Vergangenheit Abkommen abschwächte und letztendlich gar nicht unterzeichnete. Jetzt könne sich der Rest der Welt an die Aufgabe machen, eine gerechte und freiheitliche Architektur zu entwerfen: “Die Beseitigung extremer Ungleichheit durch internationale Zusammenarbeit und integrative Institutionen ist die wahre Alternative zum zunehmenden Autoritarismus.” Die Selbstisolierung Amerikas biete die Chance, die Globalisierung auf einer wirklich multilateralen Grundlage neu zu gestalten – ein “G-minus-eins für das 21. Jahrhundert”.
In medialer Hinsicht plädiert Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen bei den traditionellen Medien für eine Berichterstattung, die weder den Moralapostel bedient, noch angesichts der Gefährdung der demokratischen Ordnung auf dem Neutralitätsideal verharrt. Notwendig seien moralische Klarheit und Distanz gleichermaßen: “Vielleicht braucht es im Angesicht der Zerbrechlichkeit der Welt eine Zwischenform, eine Mixtur der Positionen, die man engagierte Objektivität nennen könnte.” Das bedeute, sich dem Ernst der Situation zu stellen, aber sich gleichzeitig um mehr Nahbarkeit und Fehlertransparenz zu bemühen, um »mehr Empathie für die Seelenlage des Publikums, geleitet von der Einsicht, dass kein Mensch dauerhaft im Dunkel der Dystopie leben mag«.
Unternehmer und Investoren wiederum sind gefordert, bei Standortentscheidungen die sich beschleunigenden Entwicklungen so intensiv wie nie zu verfolgen und sich der Risiken bewusst zu sein, haben doch die derzeitigen tektonischen Plattenverschiebungen politischer Systeme auch massive Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte. “Repressive und autokratische Systeme agieren – verstärkt durch das Prinzip Populismus – meist politisch restriktiv und finanziell verantwortungslos”, warnt Rapp in der Studie “Globale Rezession der Freiheit”. Das betreffe Kapitalströme, Vermögenswerte oder Eigentumsrechte.
Internationale Mobilität für Unternehmen und vermögende Privatpersonen gewinnt in diesem Kontext weiter an Bedeutung – insbesondere mit Blick auf Regionen, die Stabilität, Wachstum, Sicherheit und Zukunftsperspektiven bieten. Und vor diesem Hintergrund rückt auch Mallorca in den Fokus. Die Insel kann nicht nur ein Drehkreuz für unternehmerische Mobilität sein, sondern auch eine Plattform, auf der visionäre Investoren, verantwortungsbewusste Persönlichkeiten und kreative Köpfe gemeinsam Zukunft gestalten.
Zusammenfassung und Fazit
Im Spannungsfeld globaler Umbrüche und gegensätzlicher Entwicklungen bei Transparenz und Regulierung zeigt sich ein deutlicher Kontrast zwischen Europa und den USA. Während die EU eine Ära verschärfter Finanzaufsicht, Vermögenstransparenz und Regulierung einleitet, fährt die US-Regierung unter Donald Trump einen radikalen Deregulierungs- und Sparkurs, der die Finanzkontrolle massiv schwächt und internationale Standards untergräbt. Diese gegensätzlichen Ansätze stehen exemplarisch für eine tiefere Systemfrage: Demokratische Gesellschaften drohen, unter Reformstau, wachsender Ungeduld und einem weltweiten Trend zur Autokratie an Boden zu verlieren. Populismus, Komplexitätsüberforderung und mediale Polarisierung verstärken eine allgemeine Gereiztheit und die Sehnsucht nach einfachen Lösungen – oft auf Kosten freiheitlicher Prinzipien. Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen und vermögende Privatpersonen mehr denn je gefordert, geopolitische Entwicklungen genau zu beobachten, um sichere Standorte für ihre unternehmerische und private Zukunft zu wählen – wobei Mallorca sich zunehmend als stabiler, zukunftsorientierter und international vernetzter Standort positioniert.
Autor: Willi Plattes