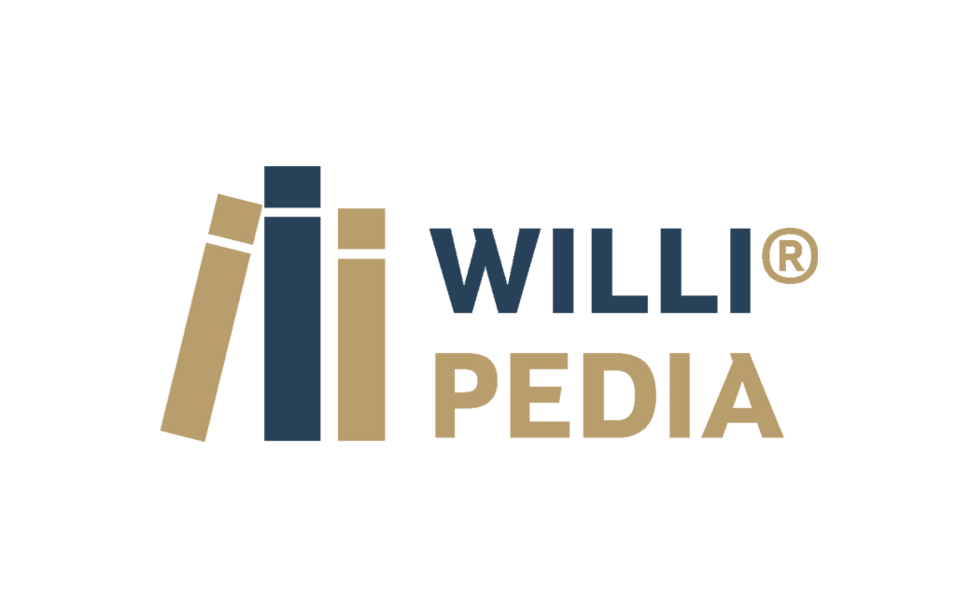Erbschaftsteuer in Deutschland: Die Reform kommt, sind Sie vorbereitet?
12. Oktober 2025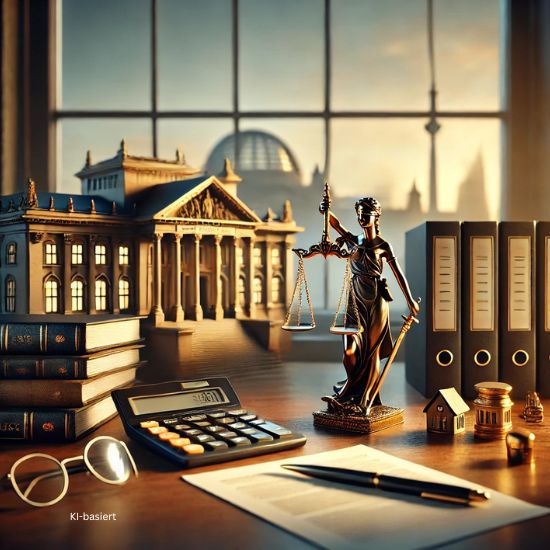
Die politische Debatte in Berlin über die Konsolidierung des Bundeshaushalts hat die Erbschaft- und Schenkungsteuer erneut in den Mittelpunkt gerückt. Unter dem Eindruck zunehmender Finanzierungslücken wird in Regierung und Parlament offen darüber nachgedacht, die bestehenden Begünstigungen zu überprüfen, Stellschrauben enger zu fassen und Bewertungsfragen neu zu justieren.
Besonders im Fokus stehen die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen – also die Frage, unter welchen Voraussetzungen Unternehmenswerte bei Generationenwechseln steuerlich privilegiert bleiben dürfen. Die Diskussionslage ist dabei zweigeteilt: Einerseits der politische Wunsch, Missbrauch zu verhindern und mehr fiskalischen Spielraum zu gewinnen; andererseits die ökonomische Einsicht, dass Familienunternehmen Substanz, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung sichern – und deshalb planbare, verlässliche Rahmenbedingungen brauchen.
Nachjustieren oder Kriterien spürbar verschärfen?
Zentraler Prüfstein sind die bekannten Verschonungsmechanismen für Betriebsvermögen mit ihren Voraussetzungen rund um Lohnsummen, Behaltensfristen und die Abgrenzung von Verwaltungsvermögen. Politische Vorschläge reichen von “Feinschrauben” – präzisere Definitionen, strengere Dokumentationspflichten, engere Ausnahmen – bis hin zu spürbaren Verschärfungen wie erhöhte Anforderungen an die Substanznähe des Vermögens, striktere Behaltepflichten oder engere Spielräume bei Holding-Strukturen.
Parallel dazu wird die Bewertung als Hebel diskutiert: Über Bewertungsparameter – insbesondere bei Immobilien und Unternehmenswerten – lässt sich das Steueraufkommen verändern, ohne den Tarif anzufassen. Das hat Charme für den Gesetzgeber, erhöht aber die Unsicherheit für Planerinnen und Planer, weil selbst kleine Parameteränderungen zu erheblichen Mehrwerten in der steuerlichen Bemessungsgrundlage führen können.
Hinzu kommt die gerichtliche Dimension. Das Bundesverfassungsgericht könnte die Koalition schon bald zu einer Reform der Erbschaftsteuer zwingen. Offene Verfahren mit Bezug zu Begünstigungen und Bewertungsfragen können politischen Druck ausüben und den zeitlichen Pfad einer Reform beeinflussen. Der Ausgang einzelner Verfahren ist naturgemäß offen; denkbar sind sowohl Bestätigungen der Grundlinien als auch Korrekturen im Detail. Für die Praxis ist entscheidend: Rechtsprechung und Gesetzgebung greifen ineinander. Wer Nachfolge plant, sollte Szenarien nicht nur rechtlich, sondern auch zeitlich denken – hier geht es um Stichtage, Übergangsregelungen, mögliche Vertrauensschutzmechanismen und die Abgrenzung zwischen “alt” und “neu”.
Drei Grundszenarien in der politischen Debatte
In der politischen Diskussion lassen sich drei Grundszenarien unterscheiden:
Feinschrauben-Szenario: Es bleibt beim System, aber Definitionen und Nachweispflichten werden geschärft; Verwaltungshinweise und Prüfungstiefe nehmen zu.
Verschärfungs-Szenario: Begünstigungen werden substantiell reduziert, Quoten sinken, Lohnsummen- und Behalteauflagen werden strenger, Verwaltungsvermögen wird enger gefasst.
Bewertungsszenario: Der Gesetzgeber nutzt Bewertungsrecht als Aufkommenshebel – etwa über Liegenschaftszinsen, Bodenrichtwerte, Kapitalisierungsparameter, Goodwill-Methodik oder die Einordnung bestimmter Vermögensklassen.
Alle drei Pfade hätten unterschiedliche Folgen für Liquidität, Strukturierungslogik und Transaktionszeitpunkte.
Was jetzt zu tun ist
Für Familienunternehmen und vermögende Privatpersonen folgt daraus ein klarer Handlungsauftrag: Planbarkeit herstellen.
Das beginnt mit einer nüchternen Inventur: Welche Vermögensarten sind betroffen? Wie ist die heutige Abgrenzung zwischen betrieblicher Substanz und Verwaltungsvermögen? Wo liegen mögliche Schwachstellen, etwa hohe Kassenbestände, “junges” Finanzvermögen, überkomplexe Holding-Kaskaden oder vermischte Asset-Pools? Wer hier rechtzeitig aufräumt – Funktionsverdichtung, klare Zuordnung, saubere Cash-Management-Regeln – gewinnt Robustheit gegen unterschiedliche Reformpfade und reduziert Angriffsflächen in Betriebsprüfungen.
Ein zweiter Baustein ist die Bewertungsvorbereitung. In unsicheren Zeiten hilft Bewertungs-Readiness: belastbare Dokumentation, nachvollziehbare Gutachtenmethodik, aktuelle Kennzahlen, saubere Datentöpfe. Das gilt insbesondere für Immobilienportfolios, deren steuerliche Werte stark von Marktparametern und Bewertungsregeln abhängen. Bei Unternehmenswerten lohnt ein transparenter Blick auf Ertragskraft, Working Capital, Verschuldung und Sondereffekte; ebenso auf die Zuordnung von Vermögensgegenständen zur operativen Substanz. Wer Bewertungsfragen antizipiert, vermeidet Überraschungen - und verschafft sich Argumente, wenn Parameter politisch oder verwaltungsseitig nachjustiert werden.
Zeitliche Steuerung. Nicht jede Übertragung gehört “sofort” umgesetzt; aber laufende Projekte sollten auf mögliche Stichtage und Übergangsregeln hin überprüft werden. Es kann strategisch sinnvoll sein, einzelne Schritte vorzuziehen - etwa die Überführung klar substanznaher Assets - und andere zu verschieben, bis mehr Klarheit über die endgültige Ausgestaltung besteht. In jedem Fall sind Testate, Beschlüsse und Protokolle sorgfältig zu führen; sie belegen die unternehmerische Rationalität der gewählten Strukturierung und stützen den Vertrauensschutz, soweit der Gesetzgeber ihn vorsieht.
Liquiditätsplanung. Selbst bei fortbestehenden Begünstigungen bleibt die Frage, ob und wann Liquidität für Steuerzahlungen erforderlich wird - etwa, wenn Voraussetzungen temporär nicht erfüllt werden können oder Bewertungsänderungen die Bemessungsgrundlage erhöhen. Eine vorausschauende Liquiditätsarchitektur - Ausschüttungspolitik, Kreditlinien, Family Pooling, gezielte Desinvestitionen - verhindert Zwangslagen und erhält unternehmerische Handlungsfähigkeit. In Familienunternehmen sollte dieser Punkt in die Governance-Dokumente (Familienverfassung, Beiratsregeln) integriert werden.
Internationale Perspektive. Für mobil aufgestellte Unternehmerfamilien sind grenzüberschreitende Sachverhalte die Regel, nicht die Ausnahme. Neben der deutschen Erbschaft- und Schenkungsteuer spielen ausländische Regime, Doppelbesteuerungsabkommen, Zurechnungsnormen und zivilrechtliche Anknüpfungen – zum Beispiel an den gewöhnlichen Aufenthalt – zusammen. Wer Immobilien oder Beteiligungen in mehreren Jurisdiktionen hält, sollte eine konsolidierte, länderübergreifende Planung erstellen – mit Blick auf Steuerfolgen, Reporting-Pflichten, Registertransparenz und die praktische Vollzugsfähigkeit im Erb- und Schenkungsfall. Gerade an der Schnittstelle zu Stiftungen und Trust-ähnlichen Strukturen gilt es, die Substanznähe sauber zu dokumentieren.
Kommunikation und Compliance. Eine Reform – ob groß oder klein – wird die Prüfungstiefe der Finanzverwaltung erhöhen. Unternehmen sollten ihre internen Prozesse so aufsetzen, dass Lohnsummen, Behaltefristen, Organe und Funktionen jederzeit prüfungssicher nachweisbar sind. Das reduziert Reibungsverluste, vermeidet Streitigkeiten und senkt die Wahrscheinlichkeit, dass formale Fehler Privilegien kosten. Für die Familie bedeutet das, die Governance auf Stand zu bringen: Rollenklarheit, Entscheidungswege, Konfliktlösungsmechanismen - und ein gemeinsam getragenes Verständnis dafür, warum bestimmte Strukturierungen gewählt wurden.
Nachfolge als zivil-, gesellschafts- und familienstrategisches Projekt
Aus all dem folgt keine Panikempfehlung, aber eine klare Priorisierung: Transparenz herstellen, Substanz stärken, Bewertungs-Readiness aufbauen, Liquidität planen und den Zeitfaktor bewusst steuern. Wer heute die Hausaufgaben macht, bleibt handlungsfähig – unabhängig davon, ob der Gesetzgeber am Ende nur an Stellschrauben dreht oder tiefere Schnitte setzt. Wichtig ist, die Diskussion nicht isoliert steuerlich zu führen: Nachfolge ist immer auch ein zivil-, gesellschafts- und familienstrategisches Projekt. Steuerrecht liefert Leitplanken, aber der Kurs wird durch Werte, Verantwortung und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bestimmt.
Lassen Sie sich beraten mit strukturierter Risikoanalyse, belastbarer Bewertungsvorbereitung und einer integrierten Nachfolgeplanung. Dazu gehören auch operative Leistungen: von steuerlichen Erklärungen über sorgfältige Prüfungen bis hin zur Begleitung komplexer Immobilientransaktionen. Anspruch sollte eine glaubwürdige, dokumentierte Beratung sein: klare Quellen- und Datumsangaben ("Stand"), nachvollziehbare Herleitungen und eine transparente Abwägung von Optionen - damit Sie Entscheidungen treffen können, die heute tragen und morgen Bestand haben.
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
-
Konferenz "Familienvermögen in Krisenzeiten": Die PlattesGroup kooperiert mit Fachseminare von Fürstenberg
Der Anbieter für hochwertige Weiterbildung in den Bereichen Recht und Steuern ist Partner bei unserem Event am 30. und 31. Januar 2026 auf Mallorca. Ausgewiesene Fachleute sprechen über die Realität globaler Mobilität.
News - 12. September 2025
...mehr -
Breites Interesse, offene Debatte und ergiebiges Networking bei der "Einladung zum Probesterben"
130 Teilnehmer informierten sich bei dem Event am 2. Mai im Club der Mallorca Zeitung über Fallstricke und Strategien bei der Nachfolgeplanung in Zeiten zunehmender internationaler Mobilität.
News - 05. Mai 2025
...mehr