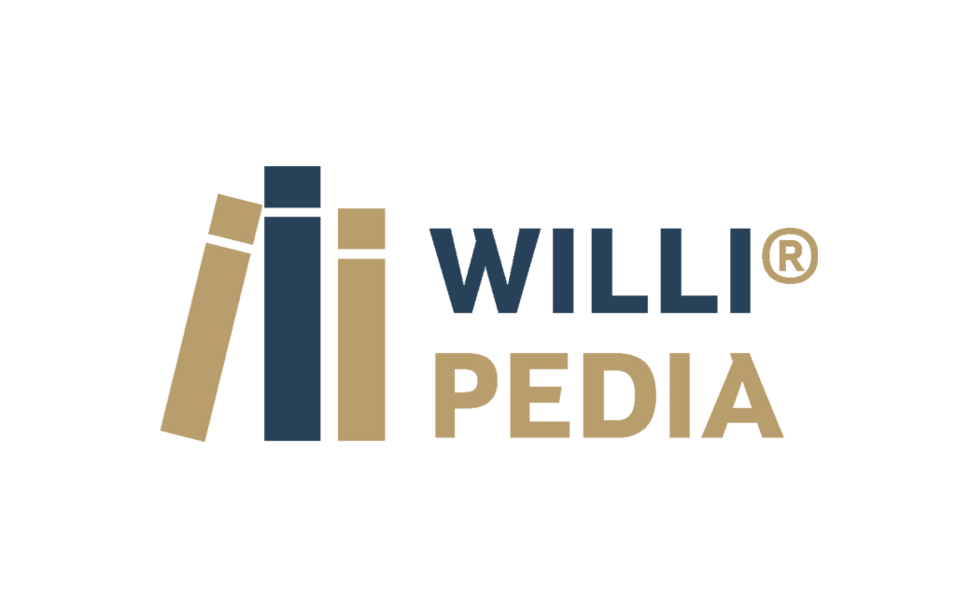Die deutsche Wegzugsbesteuerung im Visier der EU-Justiz
01. Oktober 2025
Die deutsche Wegzugsbesteuerung ist in den Fokus des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) gerückt – durch ein Vorabentscheidungsersuchen C‑430/25 („Gena“) des Verwaltungsgerichts in Polen (Wojewódzki Sąd Administracyjny). Der Fall, der Grundfragen der Freizügigkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Auswanderungsfreiheit aufwirft, hat damit das Potenzial, die seit Januar 2022 verschärften deutschen Regeln im Außensteuergesetz (AStG, § 6) maßgeblich zu beeinflussen.
In der deutschen Beratungspraxis ist schon jetzt spürbar: Die zentrale Streitfrage lautet, ob Ratenzahlungsmodelle über wenige Jahre den unionsrechtlichen Anforderungen genügen oder ob zwingend eine Stundung bis zur tatsächlichen Veräußerung – dauerhaft und zinslos – geboten ist.
Darum geht es im Gesuch aus Polen
Ausgangspunkt des Gesuchs aus Polen ist das dortige Exit‑Tax‑Regime für natürliche Personen. Es greift, wenn Steuerpflichtige nach mehrjähriger Ansässigkeit – Regelfall: mindestens fünf von zehn Jahren – Polen verlassen und dabei unter anderem stille Reserven in Kapitalgesellschaftsanteilen realisieren würden, wenn eine fiktive Veräußerung unterstellt wird.
Die polnischen Regeln setzen eine Wertsummen‑Schwelle von 4.000.000 Złoty an und kennen keine systematische Berücksichtigung stiller Lasten. Ein “Step‑up” auf den Verkehrswert bei Zuzug ist nicht vorgesehen. Im Wegzugsfall wird grundsätzlich mit 19 Prozent besteuert. Eine dauerhafte Stundung – auch bei EU‑/EWR‑Wegzügen – sieht das polnische Recht nicht vor. Zulässig ist lediglich eine Ratenzahlung über höchstens fünf Jahre.
Genau hier setzt das Vorabentscheidungsersuchen an:
- Darf Polen Wertzuwächse aus der Zeit vor dem polnischen Zuzug besteuern?
- Ist es unionsrechtskonform, stille Lasten bei der Bemessung auszuklammern?
- Reicht eine befristete Ratenzahlung aus, oder verlangt das Unionsrecht eine Stundung bis zur tatsächlichen Veräußerung der Vermögenswerte?
Warum das für Deutschland wichtig ist
Die Brisanz für Deutschland erklärt sich aus der Reform des § 6 AStG zum 1. Januar 2022. Während Wegzüge bis Ende 2021 in EU‑/EWR‑Staaten grundsätzlich eine unbefristete, zinslose Stundung ohne Sicherheitsleistung ("Ewigkeitsstundung") ermöglichten, kennt das heutige Recht nur drei Pfade: Sofortzahlung, Zahlung in sieben Jahresraten oder eine temporäre Stundung bei Rückkehr nach Deutschland. In der Praxis verlangen die Finanzämter für Raten oder Stundung regelmäßig Sicherheiten.
Betroffen sind insbesondere Anteilseigner mit mindestens einem Prozent Beteiligung (§ 17 EStG), für die bei fingierter Veräußerung die stille Reserve zum Verkehrswert zu versteuern ist. Im Teileinkünfteverfahren unterliegen 60 Prozent des Veräußerungsgewinns dem persönlichen Steuersatz; bei Anwendung des Spitzensteuersatzes ergibt sich eine effektive Belastung bis etwa 28,5 Prozent. Dass die Ewigkeitsstundung entfallen ist – und zwar trotz der EuGH‑Entscheidung Wächtler (26. 2. 2019, C‑581/17) sowie der anschließenden Linie des BFH (Urteil vom 6. 9. 2023, I R 35/20) – hat die unionsrechtliche Diskussion in Deutschland neu entfacht. Überall dort, wo heute eine Sofortkasse oder starre Raten gefordert werden, steht die Frage im Raum, ob dies die Freizügigkeit unnötig beschneidet und ob mildere, gleich geeignete Mittel – namentlich eine zinslose Stundung bis zur Realisierung – unionsrechtlich nicht zwingend sind.
Warum kein Aufschub statt Ratenzahlung?
Gerade die dritte Vorlagefrage aus Polen, die fünfjährige Ratenzahlung statt eines Realisationsaufschubs zum Gegenstand hat, ist deshalb richtungsweisend. Sie trifft den Nerv des deutschen § 6 AStG: Falls der EuGH bestätigt, dass ratenbasierte Sofortzugriffe die Freizügigkeit übermäßig belasten, wäre die siebenjährige Ratenzahlung in Deutschland kaum zu halten.
Der Gedanke dahinter ist einfach: Wer auswandert, realisiert die stillen Reserven nicht; die Liquidität entsteht erst bei einer späteren echten Veräußerung. Eine Besteuerung ohne Realisation zwingt daher zu einer Ersatzliquidität – ein Eingriff, der sich unionsrechtlich nur rechtfertigen lässt, wenn es keine gleich geeigneten, milderen Mittel gibt. Der Stundungsaufschub bis zum Veräußerungszeitpunkt, zinslos und ohne pauschale Sicherheiten, ist eben genau ein solches milderes Mittel, weil er die Besteuerungsrechte Deutschlands oder des Wegzugsstaats wahrt, die Einbringlichkeit aber nicht auf dem Rücken der Freizügigkeit finanziert.
Weitere Argumente gegen die hart konzipierte Exit Tax
Die erste polnische Vorlagefrage – der Zugriff auf Wertzuwächse aus der Voransässigkeitsphase – berührt die Grundsätze einer symmetrischen Zuweisung von Besteuerungsrechten. Wenn ein Zuwachs in einem anderen Hoheitsgebiet entstanden ist, spricht vieles dafür, dass dessen Erfassung bei Wegzug aus Polen die Grenzen einer territorial verankerten Exit‑Tax überschreitet. Die zweite Frage – der bewusste Ausschluss stiller Lasten – führt ins Herz der Bemessungsgrundlage: Eine Steuer, die nur Wertsteigerungen erfasst, ohne Wertminderungen in derselben Sphäre zu berücksichtigen, gerät in Schieflage und verschärft den Freizügigkeitseingriff unnötig. Beide Punkte verstärken die unionsrechtliche Skepsis gegenüber einem hart konzipierten Exit‑Tax‑Regime.
Wie geht es jetzt weiter?
Nach Eingang des Ersuchens beim EuGH ist mit einer mündlichen Verhandlung und Schlussanträgen im Laufe des Jahres 2026 und mit einem Urteil im Jahr 2027 zu rechnen. Auch wenn Prognosen schwierig sind: Je stärker ein nationales Recht auf sofortige Liquidität zielt, desto höher die Hürden der Verhältnismäßigkeit – zumal, wenn eine zinslose, realisationsbezogene Stundung als gleich geeignetes, weniger eingriffsintensives Mittel bereitliegt.
Empfehlungen für die Praxis
Für Unternehmer, Anteilseigner und Vermögende mit internationaler Mobilität ergeben sich daraus konkrete Handlungserfordernisse.
- Zum einen sollten vor einem Wegzug Asset‑Mapping und Bewertung der wesentlichen Vermögenspositionen (Beteiligungen, Derivate, Fonds/PE‑Interessen, Mitarbeiterbeteiligungen) strukturiert dokumentiert werden.
- Zum anderen empfiehlt sich – gerade bei EU‑/EWR‑Wegzügen – ein gestufter Antragsansatz: primär der Antrag auf dauerhafte, zinslose Stundung ohne Sicherheitsleistung, hilfsweise Ratenzahlung und weiter hilfsweise temporäre Stundung unter der Rückkehrregel. Wird die Stundung abgelehnt, kommen Einspruch und Aussetzung der Vollziehung in Betracht, gestützt auf die anhängige unionsrechtliche Klärung im Verfahren C‑430/25 sowie auf die Linie Wächtler/BFH.
- Sicherheiten sollten – falls überhaupt – nur dort hingenommen werden, wo die Verwaltung ein konkretisiertes Ausfallrisiko nachvollziehbar darlegt.
- Begleitend ist stets die DBA‑Situation (Art. 13 OECD‑MA‑Typik) zu prüfen, einschließlich etwaiger Step‑up‑Mechaniken im Zuzugsstaat, Holding‑Strukturen sowie Re‑Investment‑Überlegungen.
Die menschenrechtliche Perspektive ist dabei mehr als Rhetorik. Die Auswanderungsfreiheit als Bestandteil europäischer Grund‑ und Menschenrechte verlangt eine verhältnismäßige steuerliche Ausgestaltung. Daraus folgt die Forderung nach einer dauerhaften, zinslosen Stundung der Wegzugsteuer bis zur tatsächlichen Realisation – und zwar ohne pauschale Sicherheitsleistungen. Diese Argumentationslinie lässt sich in Verfahren vor der Finanzverwaltung und den Finanzgerichten substanziell begründen und sollte Zeit verschaffen, bis der EuGH die Maßstäbe in „Gena“ konkretisiert.
Von der steuerlichen Antragstellung über die sorgfältigen Prüfungen der Vermögensstruktur (Due Diligence) und der Begleitung von Immobilientransaktionen bis hin zur Erstellung oder Anpassung der Steuererklärungen im In- und Ausland - für Ihre spezifische Situation entwickelt die PlattesGroup eine maßgeschneiderte Strategie.
Veranstaltungshinweis: Bei unserem Event “Familienvermögen in Krisenzeiten” am 30. und 31. Januar 2026 können Sie mit Spezialisten zu diesem Thema persönlich sprechen. Veranstaltungsort: Motorworld Mallorca (Programm und Anmeldung).
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
-
Konferenz "Familienvermögen in Krisenzeiten": Die PlattesGroup kooperiert mit Fachseminare von Fürstenberg
Der Anbieter für hochwertige Weiterbildung in den Bereichen Recht und Steuern ist Partner bei unserem Event am 30. und 31. Januar 2026 auf Mallorca. Ausgewiesene Fachleute sprechen über die Realität globaler Mobilität.
News - 12. September 2025
...mehr