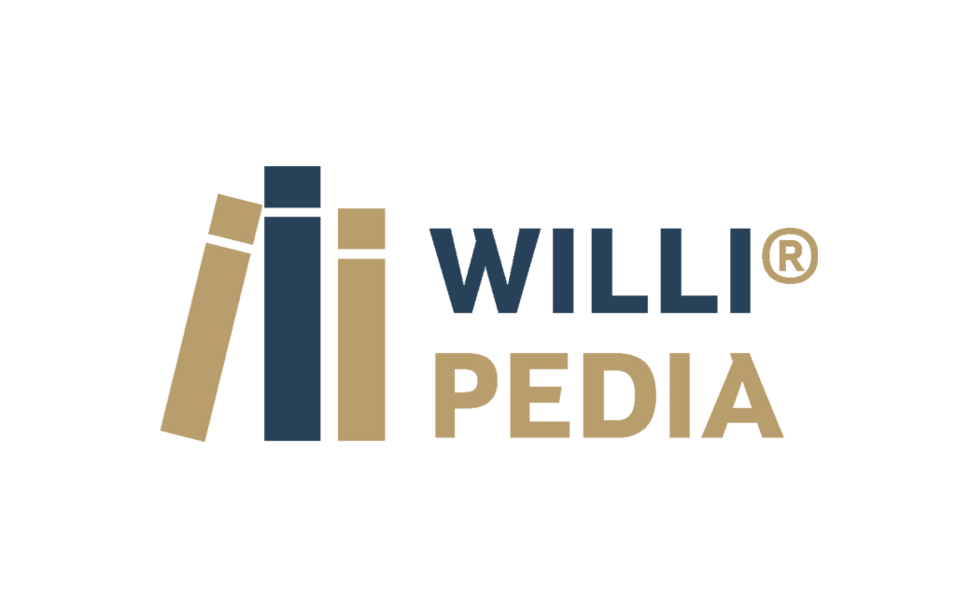Der EU-Binnenmarkt als Sperrgebiet des deutschen Fiskus? Höchste Zeit für eine Reform der Wegzugsbesteuerung
11. Juni 2025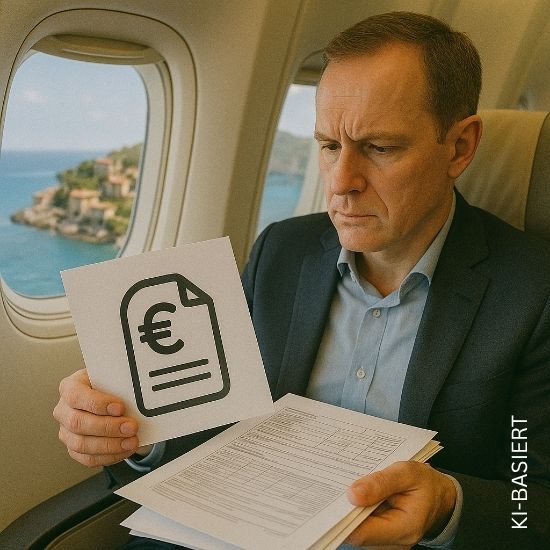
In einer Zeit, in der Unternehmen und Unternehmerfamilien zunehmend global denken und grenzüberschreitend agieren, wirkt die deutsche Wegzugsbesteuerung wie ein Relikt vergangener Steuerpolitik. Sie stammt aus einer Ära, in der Mobilität eher als Bedrohung denn als Normalfall gesehen wurde – und genauso behandelt sie auch den Wegzug eines Steuerpflichtigen: als steuerliches Risiko, das präventiv bekämpft werden muss.
Dabei geht es keineswegs um Steuerflucht oder aggressive Gestaltungen. Es geht um ganz reale Lebensentscheidungen von Unternehmern, Gesellschaftern, Familien – und um die Frage, ob das deutsche Steuerrecht diese Freiheit schützt oder bestraft.
Ein scharfes Schwert: Steuer ohne Einnahme
Das Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen, kurz AStG, unterstellt in Paragraf 6 bei einem Wegzug ins Ausland einen fiktiven Verkauf von Kapitalgesellschaftsanteilen, sofern die Beteiligung ein Prozent übersteigt (§ 17 EStG). Die Folge: Der Wertzuwachs dieser Beteiligung – also die stillen Reserven – wird besteuert, obwohl kein Verkauf stattgefunden hat. Und: obwohl dem Steuerpflichtigen kein einziger Euro zugeflossen ist.
Diese Fiktion steht im offenen Widerspruch zum Realisationsprinzip – einem der tragenden Grundsätze des deutschen Einkommensteuerrechts. Steuerpflicht entsteht dort, wo reale wirtschaftliche Vorgänge vorliegen, nicht bloße hypothetische Konstruktionen.
Zu einem der schärfsten Kritikern dieser Regelung gehört Prof. Dr. Wolfgang Schön. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in München und zählt zu den renommiertesten Steuerrechtlern Europas. Seine Arbeiten zum Steuerverfassungsrecht, zur Unternehmensbesteuerung und zum europäischen Steuerrecht genießen hohe Anerkennung – in Wissenschaft, Politik und Rechtsprechung.
Schön nennt die Wegzugsbesteuerung einen Systembruch und stellt klar: „Die Verlagerung des Wohnsitzes ist kein ökonomisches Realisationsereignis. Die Fiktion eines Veräußerungsgewinns führt zu einer Besteuerung von Substanz ohne Gegenleistung.“ Und in der Tat: Diese Fiktion mag fiskalisch attraktiv sein – sie ist aber steuerpolitisch verheerend. Sie trifft nicht diejenigen, die Gewinne realisieren, sondern diejenigen, die ihr Recht auf Mobilität in Anspruch nehmen.
Eingriff in die Grundfreiheiten der EU
Noch gravierender wird die Situation, wenn man das Ganze aus europarechtlicher Perspektive betrachtet. Die Wegzugsbesteuerung entfaltet ihre Wirkung nicht bei Verkäufen oder Ausschüttungen, sondern ausschließlich bei Wohnsitzverlagerungen – also bei Ausübung eines Grundrechts der Europäischen Union. Das europäische Unionsrecht (AEUV) garantiert in den Artikeln 49 und 54 die Niederlassungsfreiheit – auch für natürliche Personen. Doch wer sich innerhalb der EU bewegt, muss mit einem fiktiven Steuerzugriff rechnen. Wer in Deutschland bleibt, wird nicht besteuert. Wer aber sein Grundrecht auf Mobilität innerhalb der Union ausübt, wird mit einem fiktiven Steuerzugriff belegt. Das ist ein klarer Verstoß gegen EU-Recht.
In der steuerrechtlichen Literatur ist der Tenor eindeutig: Die Wegzugsbesteuerung wird vielfach als europarechtswidrig eingestuft – und zunehmend auch als wirtschaftlich kontraproduktiv.
Prof. Dr. Wolfgang Kessler und Dr. Christian Overesch etwa kritisieren eine „strukturell ungeeignete“ Regelung, die dem Integrationsgedanken des Binnenmarkts widerspricht.
Die Autoren Hey/Lohr sprechen sogar von einem „versteckten Austrittszoll“ – ein Begriff, der treffender kaum sein könnte.
In der Zeitschrift “Steuer und Wirtschaft” (StuW) ist wiederholt von einem „verfassungs- und europarechtlichen Korrekturbedarf“ die Rede.
Der Grundtenor: Das deutsche Steuerrecht baut Hürden auf, wo der europäische Binnenmarkt Mobilität ermöglichen soll und will.
Befürworter der Wegzugsbesteuerung verweisen regelmäßig auf die zinslose Stundung, wie sie für EU-Wegzüge vorgesehen ist (§ 6 Abs. 5 AStG). Doch wer die Praxis kennt, weiß: Diese Stundung ist an so viele Bedingungen, Nachweispflichten und Formalismen geknüpft, dass sie faktisch kaum angewandt werden kann:
jährliche Bescheide
Gefahr der Sofortversteuerung bei Veräußerung oder Umstrukturierung
Rückwirkung bei kleinsten formalen Fehlern
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinen Entscheidungen – unter anderem National Grid Indus und Kommission gegen Dänemark – klar gestellt: Die tatsächliche Nutzbarkeit der Stundung ist entscheidend, nicht ihre theoretische Existenz. Hier liegt ein eklatanter Umsetzungsfehler Deutschlands, der wohl früher oder später wieder vor dem EuGH landen wird.
Missbrauchsvermutung statt Einzelfallprüfung
Ein weiteres Problem liegt in der politischen Rhetorik rund um die Wegzugsbesteuerung. Oft wird suggeriert, es gehe darum, Steuerflucht zu verhindern. Doch diese pauschale Argumentation basiert auf Generalverdacht, nicht auf Differenzierung. Das Unionsrecht kennt aber keinen pauschalen Missbrauchsvorbehalt – es verlangt einzelfallbezogene Verhältnismäßigkeit. Leider wird die Mobilität unter Generalverdacht gestellt. Mobilität ist kein Missbrauch. Sie ist Ausdruck unternehmerischer Freiheit – und genau dafür sollte ein modernes Steuerrecht Raum schaffen.
Reformbedarf – aber wie?
Prof. Schön und andere schlagen praktikable Alternativen vor:
Die Besteuerung könnte nachgelagert im Veräußerungsfall erfolgen – mit Rückfallklausel
Deutschland könnte sich ein Besteuerungsrecht auf Zeit sichern, zum Beispiel für einen Zeitraum von fünf Jahren.
Eine Harmonisierung mit dem Wohnsitzstaat könnte per Verständigungsverfahren erfolgen.
Diese Ansätze wären mit dem EU-Recht vereinbar, würden Unternehmern Planungssicherheit geben – und dem deutschen Fiskus dennoch eine Beteiligung am Wertzuwachs sichern, wenn es tatsächlich zur Realisierung kommt.
Mein Fazit: Steuerpolitik braucht Vertrauen, nicht Kontrolle
Für mich ist klar: Die derzeitige Ausgestaltung der Wegzugsbesteuerung ist ein Hindernis – kein Schutz. Sie sendet das Signal: “Bleib, oder du wirst bestraft.” Das ist kein modernes Steuerrecht – das ist Abschottung durch die steuerliche Hintertür.
Internationale Mobilität ist längst Realität. Sie gehört nicht nur zur Lebenswirklichkeit unserer Mandanten, sondern ist Ausdruck europäischer Freiheit. Wer das infrage stellt, gefährdet nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – sondern auch das Vertrauen in einen fairen Rechtsstaat.
Empfehlung an Unternehmer und Gestalter:
Wegzugsbescheide innerhalb der EU immer prüfen und gegebenenfalls unter dem Vorbehalt der Europarechtswidrigkeit anfechten.
Die zinslose Stundung aktiv beantragen – und sich nicht von bürokratischen Hürden abschrecken lassen.
Argumentieren Sie mit Fachliteratur, EuGH-Rechtsprechung und Meinungsführern wie Prof. Schön – Sie sind mit Ihrer Kritik nicht allein.
Der deutsche Fiskus darf den europäischen Binnenmarkt nicht zum Sperrgebiet erklären. Es ist Zeit für eine Neuausrichtung – juristisch, politisch und steuerethisch.
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
-
Wie globale Mobilität ohne fiskalische Kollateralschäden gelingen kann
Während Leistungsträger zunehmend global agieren, schotten sich die Steuersysteme immer stärker voneinander ab. Eine Analyse von CEO Willi Plattes über grenzüberschreitende Strategien zur Verhinderung eines finanziellen Großschadensereignisses.
News - 03. März 2025
...mehr