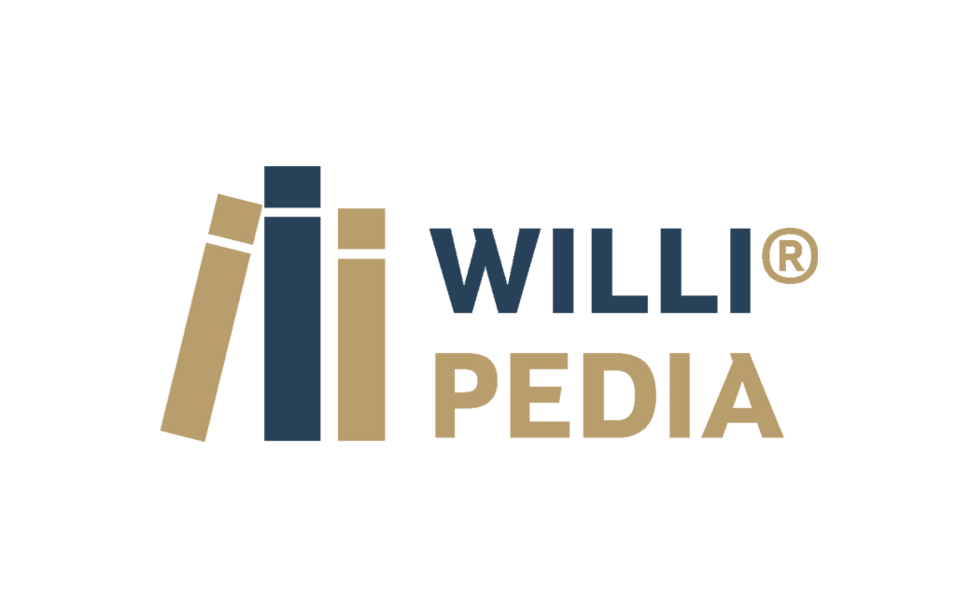Transparenzregister vor grundlegender Reform: neue EU-Vorgaben zum "wirtschaftlichen Eigentümer"
21. Oktober 2025
Die Regelungen zum europäischen Transparenzregister stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Ab Mitte 2027 gelten in der Europäischen Union neue Bestimmungen, die insbesondere Familiengesellschaften und Familienstiftungen betreffen. Künftig ist nicht mehr vom „wirtschaftlich Berechtigten“, sondern vom „wirtschaftlichen Eigentümer“ die Rede – ein begrifflicher, aber vor allem inhaltlicher Einschnitt mit erheblichen Folgen für Unternehmen und Privatpersonen.
Bereits seit dem Jahr 2017 sind Gesellschaften und Stiftungen verpflichtet, die dahinterstehenden natürlichen Personen offenzulegen. Ziel dieser Transparenzpflicht ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Nun steht eine umfassende Reform an: Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie werden die bisherigen nationalen Regelungen durch ein harmonisiertes EU-System ersetzt. Kernstück ist ein europaweites Zentralregister, das die bisherigen Transparenzregister ablöst und deutlich strengere Vorgaben beinhaltet.
Neue Maßstäbe für die Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer
Die EU-Geldwäscheverordnung enthält detaillierte Regeln, die künftig unmittelbar gelten:
Gesellschaften:
Eigentum oder Kontrolle können die Eigenschaft als wirtschaftlicher Eigentümer begründen.
Bereits eine Beteiligung von 25 statt bisher mehr als 25 Prozent genügt.
Neben Stimmrechten wird nun auch die Gewinnbeteiligung einbezogen – damit können zum Beispiel Nießbraucher erfasst sein.
In mehrstufigen Beteiligungsstrukturen führt eine neue Berechnungsmethode oft zu anderen Ergebnissen als bisher.
Auch Personen mit erheblichem Einfluss ohne formale Beteiligung gelten als wirtschaftliche Eigentümer.
Stiftungen:
Der Stifter gilt künftig stets als wirtschaftlicher Eigentümer.
Begünstigte müssen auch dann erfasst werden, wenn sie noch nicht konkret bestimmt sind.
Werden Stiftungen in Gesellschaftsstrukturen eingebunden, führt dies zu einer durchgehenden Transparenz: Die Eigentümer der Stiftung gelten zugleich als Eigentümer der von ihr gehaltenen Gesellschaften.
Unklar ist bislang, ob künftig auch sämtliche Personengesellschaften, einschließlich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), erfasst sein werden.
Fristen und Pflichten ab 2027
Inkrafttreten: Spätestens ab dem 10. Juli 2027 gelten die neuen Regelungen.
Umfangreiche Datenerhebung: Gesellschaften und Stiftungen müssen detaillierte Informationen einholen und vorhalten, darunter auch Ausweisdaten der wirtschaftlichen Eigentümer.
Aktualisierungspflicht: Änderungen sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 28 Tagen, zu melden. Zusätzlich sind jährliche Routineprüfungen vorgeschrieben.
Ersatzmeldung: Kann kein Eigentümer festgestellt werden, müssen Angaben zur Geschäftsführung übermittelt werden.
Sanktionen: Bei Verstößen drohen Geldbußen sowie die öffentliche Bekanntmachung („naming and shaming“).
Zugang zum Zentralregister
Die Register werden EU-weit vernetzt und digital zugänglich sein. Behörden und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz erhalten umfassenden Zugang. Auch Dritte können Einsicht beantragen, sofern sie ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen – definiert durch einen weit gefassten Katalog. Dies könnte den Kreis der Zugangsberechtigten erheblich erweitern.
Einschränkungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, etwa bei Minderjährigen, geschäftsunfähigen Personen oder wenn ein außergewöhnlich hohes Risiko von Straftaten besteht. Für sehr vermögende Privatpersonen könnte dies von besonderer Bedeutung sein.
Folgen für Familienunternehmen und Stiftungen
Gerade Familiengesellschaften und Familienstiftungen stehen vor erheblichen Herausforderungen:
Komplexe Beteiligungs- und Kontrollstrukturen müssen neu bewertet werden.
Transparenzpflichten greifen tief in die Privatsphäre und in vertrauliche Strukturen ein.
Schon kleine Abweichungen bei der Ermittlung können zu völlig neuen Ergebnissen führen.
Handlungsempfehlung
Angesichts enger Fristen, steigender Komplexität und potenziell erheblicher Sanktionen sollten Betroffene frühzeitig handeln. Dazu gehören:
eine individuelle Überprüfung der Eigentümerstrukturen,
die rechtzeitige Anpassung interner Prozesse,
sowie eine laufende Aktualisierung der Daten und Meldungen.
Die Reform bedeutet für viele Gesellschaften und Stiftungen nicht nur zusätzlichen administrativen Aufwand, sondern auch eine tiefere Transparenz gegenüber Behörden und teilweise auch gegenüber der Öffentlichkeit. Wer rechtzeitig reagiert, kann Risiken und Bußgelder vermeiden – und bleibt auf der sicheren Seite.
Podcastfolgen zum Thema
Weiterführende Informationen zum Thema
-
Immobilienkäufer müssen für Grundsteuer-Schulden des Vorbesitzers geradestehen
Eine verbindliche Auskunft der spanischen Steuerbehörde stellt klar, wer für die jährlich erhobene kommunale Abgabe im Fall eines Eigentümerwechsels aufkommen muss - und wie die Haftung geregelt ist.
News - 26. September 2025
...mehr -
Justiz in Spanien erklärt Diskriminierung von Nicht-EU-Bürgern bei Vermietung für unzulässig
Unter anderem Schweizer können aktuell ihre Kosten nicht in der spanischen Steuererklärung geltend machen. Das sei nicht mit EU-Recht vereinbar, urteilt der Nationale Gerichtshof.
News - 26. August 2025
...mehr